Italien nimmt eine zentrale Rolle im Warenverkehr von und nach Europa ein und verfügt bereits heute über ein gut ausgebautes Infrastrukturnetz. Während etablierte Logistikmärkte wie Deutschland, die Niederlande oder Frankreich als weitgehend gesättigt gelten, weist der italienische Markt jedoch weiterhin Wachstumspotenzial auf.
Ein Indikator für die positive Entwicklung ist der Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank: Zwischen 2012 und 2023 konnte sich Italien im internationalen Ranking von 24 auf 19 verbessern (siehe Abbildung 1a). Bewertet werden unter anderem Aspekte wie Zollabwicklung, Infrastrukturqualität, Lieferzuverlässigkeit und Sendungsverfolgung. Wie die Abbildung 1b veranschaulicht, hat Italien insbesondere in den Bereichen Internationale Transporte und Zollabfertigung Optimierungspotential, aber auch bei Logistikkompetenz und Infrastruktur ist der Abstand zu den führenden Nationen wie Niederlande und Deutschland noch ausgeprägt1.
Vorangetrieben wird das Wachstum durch eine dynamische Entwicklung im E-Commerce-Sektor, dem Ausbau von Logistiknetzwerken und der Verbesserung der Infrastruktur, wobei sich diese Entwicklungen teilweise einander bedingen.
Italiens Wirtschaft war stark von der Corona-Pandemie betroffen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im Jahr 2020 um -8,95 % was eine der tiefsten Rezessionen in der Eurozone (-6,15 %)2 darstellte. Der Einbruch folgte aus den strengen Lockdowns, die viele Wirtschaftssektoren lahmlegten. Besonders beeinträchtigt waren die Gastronomie, der Tourismus sowie die Fertigungsindustrie.
Mit dem 2021 beschlossenen Corona-Wiederaufbaufonds der EU als Teil der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), einer Leitinitiative der EU mit dem Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern, kann Italien bis 2027 191,5 Milliarden Euro Fördergelder abrufen, um seine Wirtschaft zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten3. Unter anderem soll dieses Geld dazu dienen, diverse Infrastrukturprojekte voranzutreiben:
Dazu gehören:
Ein zentrales Anliegen der italienischen Regierung und Wirtschaft ist auch der Ausbau des Breitband- und 5G-Netzes, um die Digitalisierung zu fördern. Im Jahr 2023 nutzten 87,0 % der italienischen Bevölkerung das Internet. Der Anteil in Deutschland lag hier bereits bei 92,5 %5. Neben generellen Vorteilen für Bevölkerung und Wirtschaft durch den Ausbau des 5G-Netzes ist dies auch die Basis für ein weiteres Wachstum des E-Commerce-Sektor. Für das Jahr 2025 wird ein E-Commerce-Umsatz von etwa 39,3 Mrd. erwartet, der bis 2029 auf 51,4 Mrd. Euro ansteigen soll. Prozentual entfielen im Jahr 2024 auf den Online-Handel 12,3. Bis 2029 soll er bei knapp 18 % liegen (siehe Abbildung 2)6.
Der Ausbau von 5G- und Breitbandnetzen wirkt sich in mehrfacher Hinsicht positiv aus: Neben der Förderung des Online-Handels optimiert er gleichzeitig die Betriebsabläufe an modernen Logistikstandorten. Nicht nur durch die steigende Nachfrage im E-Commerce ist die Logistikbranche in Italien in den letzten Jahren stark gewachsen. Für das Jahr 2023 lassen sich die Logistikaktivitäten (Fracht und Logistik) auf einen Gesamtwert von 117,4 Mrd. USD schätzen. Bis 2033 soll der Markt bei einem CAGR von 4,4 % auf 181,3 Mrd. USD anwachsen7.
Bis 2030 beabsichtigt Italien etwa 30 Prozent des Güterverkehrs per Zug zu bewegen. Ausgehend von 12,6 % im Jahr 2021 ein ambitioniertes Ziel8. Aus dem EU-Wiederaufbaufonds fließen allein 29,8 Milliarden Euro in Projekte, die landesweit die Anbindung des Personen- und Güterverkehrs über die Schiene verbessern sollen.
Ein Großteil dieser Maßnahmen steht im direkten Zusammenhang mit dem Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) der EU. Italien spielt dabei eine zentrale Rolle als Durchgangs- und Verbindungspunkt entlang mehrerer TEN-V-Korridore – darunter dem Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, der sich vom finnischen Helsinki über Deutschland und Italien bis nach Palermo auf Sizilien erstreckt. Zu den Schlüsselprojekten entlang dieses Korridors zählen unter anderem der Brenner Basistunnel, der eine Hochleistungsverbindung zwischen Italien und Österreich schafft, sowie der Mont-d’Ambin-Basistunnel an der Grenze zu Frankreich, Teil der neuen Hochgeschwindigkeitsachse Turin–Lyon. (siehe Abbildung 3 a/b)
Beide Alpenuntertunnelungen sind technisch und finanziell aufwendig. Auch andere Streckenführungen, etwa durch die Ardennen, stellen hohe Anforderungen an Ingenieurwesen und Planung. Zusätzlich erschwert die geologische Beschaffenheit Italiens mit ihren Erdbeben- und Erdrutschrisiken viele Schieneninfrastrukturprojekte erheblich.
Dennoch, dieser Kraftaufwand kann sich lohnen. Das Potential durch den Ausbau des Schienennetzes ist enorm hoch. Neben Fahrzeitreduzierung bringt es Italien große Schritte näher zur Erreichung der Klimaziele: Allein für den 57,5 Kilometer langen Mont-d’Ambin-Basistunnel wird eine Einsparung von etwa 1 Million Tonnen CO₂ jährlich prognostiziert9.
Auch das Straßennetz Italiens ist eng in das TEN-V-System eingebunden. Mit rund 7.000 Kilometern Autobahn, darunter strategisch wichtige Achsen wie die A1 (Mailand–Neapel) und die A4 (Turin–Triest), ist das Land integraler Bestandteil des europäischen Straßengüterverkehrs. Geplante Aus- und Neubauten entlang der TEN-V-Korridore sollen Engpässe reduzieren, die multimodale Vernetzung verbessern und grenzüberschreitende Transporte effizienter gestalten – etwa durch Anbindungen an intermodale Knotenpunkte wie Verona, Bologna oder Gioia Tauro.
Die verbesserten Verbindungen steigern langfristig die Standortqualität Italiens. Gerade für strukturschwächere Regionen in Süditalien eröffnet die bessere Anbindung an zentraleuropäische Märkte neue wirtschaftliche Perspektiven. Gleichzeitig profitiert Italien von seiner geostrategischen Lage mit Nähe zu Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Wichtige maritime Umschlagpunkte wie der Hafen Gioia Tauro – einer der größten Containerhäfen im Mittelmeerraum – und der Hafen Genua sichern den Zugang zu internationalen Lieferketten. Auch die potenzielle Wiederannäherung an die chinesische „Belt and Road Initiative“ könnte zusätzliche Impulse für Logistik und Außenhandel freisetzen.
Der italienische Logistikimmobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren sukzessive entwickelt. Allein der Flächenbestand ist in 10 Jahren um über 70 % angewachsen, und liegt heute bei rund 25 Mio. m².
Im Vergleich zu den Bevölkerungszahlen offenbart sich hier noch weiteres Wachstumspotential: wie Abbildung 4 zeigt, liegt Italien mit 0,4 m² Logistikfläche pro Einwohner hinter Deutschland (0,9 m²) und Frankreich (0,6 m²).
Dieses Potenzial wird zunehmend realisiert: Die Pipeline für Projektentwicklungen ist trotz hoher, aber immerhin stabiler, Finanzierungs- und Baukosten gut gefüllt: rund 1,3 Mio. m² spekulative Fläche sind Ende März 2025 im Bau10. – überwiegend in Norditalien und in der Region um Rom. Die Projektpipeline speist sich aus dem Bedarf an modern ausgestatteten und ESG-konformen Immobilien. Viele Projekte können bereits vor ihrer Fertigstellung vermietet werden.
Entsprechend entfällt ein sehr hoher Anteil der Anmietungen auf moderne, ESG-konforme Logistikimmobilien. Laut Colliers waren es in im vierten Quartal 2024 98 % und im ersten Quartal 2025 92 %11.
Der Flächenumsatz konnte im Jahr 2024 und im ersten Quartal 2025 nicht an die beiden starken Vorjahresergebnisse anknüpfen, zeigt sich aber dennoch sehr robust auf hohem Niveau. Ein wichtiger Treiber der Nachfrage ist der (Online-)Einzelhandel, wobei insbesondere Third-Party-Logistikdienstleister sowie große Einzelhandelsketten zu den aktivsten Nutzergruppen zählen. Vor dem Hintergrund der gezielten steuerlichen Anreize, die Italien im Zuge seiner Standortpolitik bietet, ist davon auszugehen, dass künftig auch vermehrt Unternehmen im Rahmen von Re- und Nearshoringstrategien von einer Ansiedlung im Land überzeugt werden können.
Im ersten Quartal betrug der Flächenumsatz rund 505.000 m² und lag damit um 17 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die wirtschaftliche bzw. geopolitischen Entwicklungen führen auch am italienischen Markt zu Unsicherheiten, in deren Folge, Interessenten Anmietungen und Bauvorhaben ausgiebiger und damit länger prüfen. Entsprechend ist der Leerstand leicht gestiegen, liegt derzeit bei ca. 4,9 %, wobei er in manchen Regionen weiterhin deutlich die 2-Prozent-Marke unterschreitet12.
In Mailand ist die Flächenverfügbarkeit besonders limitiert: die Leerstandsquote betrug Ende 2024 in der Logistikregion 1,7 %13. Diese Knappheit führt zu stetig steigenden Mieten. In Mailand als auch in Rom, dem zweitstärksten Markt Italiens lag die jährliche Mietpreissteigerungsrate zwischen Q4 2019 bis Q4 2024 bei je 3,6 %. Eine stärkere Dynamik konnten nur Piacenza, Genua und Bologna verzeichnen, alles drei Regionen in Norditalien, wo die Mieten im Schnitt um 5,9 % gestiegen sind14. Die Spitzenmiete lag Ende 2024 bei 5,60 EUR/m²/Monat und wurde sowohl in der Region Mailand als auch Rom aufgerufen (siehe Abbildung 5a). Innerhalb der nächsten fünf Jahre sind jährliche Mietpreissteigerungen von 2,1 % in Mailand und 1,9 % in Rom möglich15. Das Potential für weitere Mietpreissteigerungen ist in weiten Teilen Italiens hoch, auch wenn globale Herausforderungen die Dynamik bremsen (siehe Abbildung 5b).
Zugleich zeigt sich der Investmentmarkt stabil bzw. seit Sommer 2024 sogar dynamisch. Das Investitionsvolumen im Logistiksektor summierte sich für 2024 auf 2,6 Mrd. Euro, ein Plus von 51 % und im ersten Quartal 2025 auf rund 0,68 Mrd. Euro, das einem Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Diese Ergebnisse wurden durch prominente Portfolio-Transaktionen und Value-Add-Investitionen getragen16.
Die Spitzenrenditen bewegten sich zum Jahresende 2024 weitgehend seitwärts. In Piacenza und Verona, setzte bereits eine Trendumkehr ein, die Renditen gingen hier jeweils um 10 Basispunkte zurück.
Während Ende 2024 die Spitzenrenditen in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden bei ca. 4,7 % lagen, bewegen sie sich in den Top-Regionen Italiens wie in Mailand bei 5,3 % und in Rom und Bologna bei 4,5 %17. Bei gleichzeitigem Mietpreiswachstum bietet Italien damit vergleichsweise attraktivere Einstiegsrenditen als viele andere europäische Kernmärkte. Für die nächsten fünf Jahre wird eine (weitere) Kompression erwartet, das Niveau der Spitzenrendite für die Region Mailand könnte dann Ende 2029 bei 5,0 % liegen, wie Abbildung 6b aufführt:
Der stabile Nutzermarkt in Kombination mit positiven makroökonomischen Signalen stützt weiterhin die Nachfrage nach Logistikimmobilien als Anlageklasse. Das Investitionsvolumen wird aktuell jedoch durch das begrenzte Angebot an Objekten eingeschränkt, die den Anforderungen institutioneller Investoren entsprechen. Diese fokussieren sich nach wie vor auf Core-, Core+- sowie Value-Add-Strategien – mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Region Mailand.
Die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) gewinnt auch im italienischen Logistikimmobilienmarkt zunehmend an Bedeutung und wird durch regulatorische Vorgaben als auch durch Nutzer und Investoren angetrieben. Obwohl Italien im Vergleich zu anderen europäischen Märkten noch Entwicklungsbedarf hat, gibt es deutliche Fortschritte und Trends, die auf eine nachhaltigere Ausrichtung hinweisen.
Herausforderungen bleiben jedoch: Viele ältere Gebäude sind nicht ESG-konform und bedürfen Modernisierungen. Ferner hinken der Süden und die ländlicheren Gebiete hinterher. Basierend auf einer hohen Neubauaktivität in den vergangenen Jahren konnte der Norden Italiens (z. B. Lombardei, Emilia-Romagna) seine Führungsrolle bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen ausbauen.
Das dynamische Wachstum im E-Commerce sowie die strategisch günstige Lage Italiens im europäischen und mediterranen Raum machen den Markt attraktiv für Unternehmen und Investoren. Die Nähe zu Osteuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie die Anbindung an wichtige Seehäfen wie Genua und Gioia Tauro können Italiens Rolle als logistische Drehscheibe weiter stärken. Zugleich schafft der zunehmende Fokus auf ESG-konforme Neubauten sowie die staatlich geförderte Infrastrukturmodernisierung – etwa durch Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds – zusätzliche Investitionsanreize.
Risiken bestehen jedoch weiterhin. Dazu zählen strukturelle Herausforderungen in Bezug auf regionale Disparitäten – insbesondere zwischen Nord- und Süditalien – sowie auf die Qualität und ESG-Konformität des Bestands. Auch geopolitische Unsicherheiten, hohe Bau- und Finanzierungsbedingungen können die Entwicklung bremsen.
Dennoch: Italien positioniert sich zunehmend als dynamischer Wachstumsmarkt im europäischen Logistikimmobiliensektor – mit solider Nutzerbasis, wachsender Investorennachfrage und staatlicher Unterstützung, die den Wandel hin zu einem leistungsfähigen, zukunftsfähigen Logistikstandort aktiv fördert.

Country Head GARBE Industrial Real Estate Italy
5 Fragen an unseren Experten
Der italienische Logistikimmobilienmarkt zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich, basierend auf der Kombination aus knappem Angebot, attraktiven Einstiegspreisen und stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage wird sowohl von Investoren mit Fokus auf nachhaltige Entwicklungen als auch von Nutzern aus wachstumsstarken Branchen wie E-Commerce, Lebensmittel und Mode getragen. Künftig rücken vor allem ESG-konforme Brownfield-Projekte und neue logistische Wachstumsregionen außerhalb der etablierten Märkte in den Fokus. In diesem Experteninterview übernimmt Marco Grassidonio, Country Head Italy, Stellung und teilt seine Einschätzungen zur Entwicklung in seinem Heimatmarkt.
Frage: Welche Gründe sprechen aus Anlegersicht für Investments am italienischen Logistikimmobilienmarkt?
Der italienische Markt für Logistikimmobilien zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus, die ihn besonders attraktiv für Investoren machen. Zunächst einmal übersteigt der Bedarf an Logistikflächen das aktuell verfügbare Angebot, wobei die Quadratmeterzahl an Logistikfläche pro Kopf weit unter dem europäischen Durchschnitt liegt – siehe auch WHY INVEST IN ITALY, Abbildung 4 – und der Bestand an erstklassigen Flächen sehr begrenzt ist. Aus den im europäischen Vergleich historisch niedrigen Mieten ergeben sich für Italien geringere Kapitalwerte pro Quadratmeter als in anderen europäischen Märkten. Sie liegen im Schnitt unter 1.000 EUR/m² und ermöglichen Investoren nicht nur einen günstigen Einstieg, sondern auch Kapitalschutz beim Exit, da das Abwärtsrisiko bei einer späteren Veräußerung begrenzter ist.
Ferner weist der italienische Logistikmarkt traditionell eine geringe Volatilität in Bezug auf die Nettorendite auf, was dank der stetigen Mietentwicklung langfristig für positive Ergebnisse sorgt, siehe WHY INVEST IN ITALY, Abbildung 6. Die Leerstandsquote ist, wie schon angedeutet, im europäischen Vergleich immer noch niedrig – in einigen Märkten liegt sie sogar nahe Null und damit eindeutig im Bereich des Sockelleerstands.
Italien zeigt sich aktuell als wirtschaftlich vergleichsweise widerstandsfähig, insbesondere in Nordostitalien, wo das Wachstum über dem EU-Durchschnitt liegt und die Arbeitslosenquote im März 2025 deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 6,0 Prozent1 blieb. Diese wirtschaftliche Stabilität im Verbund mit einer Marktlage, die von den politischen Entwicklungen kaum beeinträchtigt wird, ist ein attraktiver Faktor für Investoren.
Frage: Welche Nachfragefaktoren bestimmen derzeit den italienischen Markt?
In Italien konzentriert sich die Nachfrage auf Anlegerseite aktuell vor allem auf Core-Plus und Value-Add-Transaktionen. Hierbei geht es Investoren darum, durch die Bereitstellung erstklassiger Logistikobjekte Werte zu schaffen, und zwar entweder durch die (ESG-orientierte) Umwandlung von Bestandsbauten oder durch Neuentwicklungen. Core-Investoren sondieren mittlerweile behutsam den Markt, ohne dass es bislang zu größeren Direktkäufen gekommen wäre, denn vermutlich hofft man noch auf eine weitere Zinssenkung und damit auf ein Nachgeben der Renditen für Staatsanleihen. Wir beobachten ein zunehmendes Interesse daran, Immobilienportfolios gezielt aufzuwerten – etwa durch Investitionen in den Bestand, die Optimierung von Mietverträgen sowie die Aktivierung von Baulandreserven. Gleichzeitig bereiten sich viele Akteure auf einen Rückgang der Anfangsrenditen in den kommenden Jahren vor und richten ihre Strategien auf eine Maximierung des Exit-Werts aus.
Der Markt auf der Mieterseite entfällt zu gleichen Teilen auf Logistiker, deren Kunden in den Bereichen E-Commerce und Großhandel (GDO) agieren, und Industrieunternehmen, die Lagerflächen für ihren E-Commerce-Handel oder für ihre Vertriebsnetze benötigen. Italiens Logistikmarkt wird von Segmenten wie Bekleidung, Lebensmittel, Pharmazeutika und Industriebauteilen dominiert, die enormen Bedarf an modernen Logistikflächen in guten Lagen haben. Führende Nachfragetreiber für hochwertige Logistikimmobilien sind vor allem die Bekleidungs- und Lebensmittelbranchen.
Kurz gesagt, die Nachfrage wird sowohl vom Transformations- und Entwicklungsbedarf der Investoren als auch vom Bedarf an Logistikflächen der Marktteilnehmer im E-Commerce, im Großhandel und in strategischen Branchen generiert.
Frage: Welche Entwicklungen werden auf dem italienischen Logistikimmobilienmarkt künftig eine besondere Rolle spielen?
In Zukunft wird sich die Entwicklung von Logistikimmobilien in Italien zunehmend auf die Sanierung von Altstandorten konzentrieren und dadurch nachhaltiges Wachstum im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen ermöglichen.
Wir erleben einen bedeutenden Wandel im Logistikimmobiliensektor in Italien. Jüngste rechtliche Regelungen in den Regionen beschränken den Flächenverbrauch und machen Entwicklungen auf der grünen Wiese immer schwieriger. Infolgedessen gewinnt die Umwandlung von Industriebrachen – also ungenutzten oder stillgelegten Industrieflächen mit Sanierungsbedarf – zunehmend an Bedeutung. In solchen Fällen wertet die Flächensanierung nicht nur den Grund und Boden auf, sondern erfüllt auch Umwelt- und Sozialanforderungen.
Die Brachflächensanierung stellt in Italien somit eine sehr wichtige Ressource für künftige Logistik-Investments dar. Auch wenn derartige Projekte im Vergleich zu Neuentwicklungen Zusatzkosten für Abriss, Rückbau und städtische Erneuerungsmaßnahmen mit sich bringen, werden diese Nachteile durch erhebliche Vorteile vor allem im ESG-Bereich aufgewogen. Sie verringern nicht nur die Umweltbelastung, sie wirken sich auch positiv auf das soziale Umfeld aus, schaffen innerörtliche Arbeitsplätze, verbessern die Infrastruktur, sorgen ggf. auch für neue Dienstleistungsangebote und wertvolle Gemeinschaftsflächen gerade in strukturschwachen, belasteten Gegenden.
Auch GARBE Industrial Real Estate Italy folgt diesem Trend, indem es sich auf Brownfield-Entwicklungen konzentriert, um innovative und nachhaltige Logistikprojekte zu verfolgen, die den hohen Umwelt- und Sozialstandards des heutigen Marktes entsprechen. Unser Schwerpunkt bei Brownfield-Entwicklungen folgt dem Ansatz der sogenannten ‚Sustainonomics‘, einem vom Geschäftsführenden Gesellschafter Christopher Garbe eingeführten Konzept, das nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für wirtschaftlichen Mehrwert zugunsten der Investoren und der örtlichen Kommunen sorgt.
Frage: Wie schätzen Sie das potenzielle Mietwachstum in Italien in den kommenden Jahren ein?
Im Vergleich zur Ausgangslage vor der Pandemie, als die Quadratmetermieten bei 3,00 – 4,00 € pro Monat lagen, haben sich die Mieten in den letzten Jahren stark entwickelt, und zwar schneller als die Inflation. Nach unseren Beobachtungen bewegen sich Mietzuwächse aktuell im üblichen Rahmen. Italien hat sich mit einem jährlichen Inflationsziel von 2 Prozent an den europäischen Benchmarks ausgerichtet. Dieses Ziel erreichen wir auch im April 20252. In den kommenden Jahren rechnen wir mit Mietzuwächsen, die wenige Prozentpunkte über der Inflation liegen dürften und somit die Stabilität und das nachhaltige Wachstum des Marktes abbilden.
Frage: Welche Regionen Italiens werden künftig als Logistikstandorte Bedeutung gewinnen, und inwiefern unterscheiden sie sich von etablierten Märkten wie etwa Mailand?
Es gibt mehrere aufstrebende Regionen, die bereits jetzt eine wichtige Rolle spielen, so beispielsweise das Umland der Hafenstadt Genua, welches sich von Serravale bis Casei Gerola erstreckt. Diese Region bietet attraktive Gelegenheiten für die Lagerhaltung und europaweite Distribution. Auch dem Korridor von Verona zum Brenner kommt bereits eine hohe und stetig steigende Bedeutung zu. Ferner wird sich die Region zwischen Rom und Neapel in den kommenden Jahren weiter entwickeln.
Abgesehen von Mailand rechnen wir allgemein mit Zuwächsen in Süditalien und entlang der Adriaküste. Diese Regionen bieten spezielle logistische Vorteile und geraten zunehmend ins Visier von Investoren und Branchenakteuren auf der Suche nach Alternativen zu den etablierten Märkten.
Innerhalb weniger Jahre ist das Thema Verteidigung an die Spitze nationaler Agenden gerückt – mit milliardenschweren Investitionsplänen, die in ganz Europa angekündigt wurden. Ein erheblicher Teil dieser Budgets ist für neue Ausrüstung vorgesehen, womit Verteidigung zu einem zentralen Wachstumstreiber für die europäische Industrieproduktion – und für Industrie- & Logistikimmobilien (I&L) – wird. Angesichts dieser ehrgeizigen, langfristigen Verpflichtungen ist es entscheidend, den Fahrplan zu verstehen, um sich in dieser neuen Ära verteidigungsgetriebener wirtschaftlicher Transformation zurechtzufinden.
Ausrüstung als Hauptprofiteur:Die Beschaffung von Ausrüstung wird voraussichtlich den größten an den steigenden Verteidigungsausgaben ausmachen. Europäische Armeen stocken ihre Munitionsbestände auf, modernisieren schwere Bodentruppen und investieren in aufkommende Technologien wie Drohnen und autonome Systeme. Wie in Abbildung 2 dargestellt, wird der Effekt auf die verarbeitenden Industrien erheblich sein: Der Anteil der Ausrüstungsbeschaffung an den gesamten Verteidigungsausgaben könnte auf über 40 % steigen – und sich damit im Vergleich zur Zeit vor der Invasion verdoppeln.2 |
Verlagerung von Fertigung und Produktion zurück nach Europa – für Europa:
Strategische Initiativen konzentrieren sich derzeit darauf, Fertigungskapazitäten und Know-how zurück nach Europa zu holen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von politischen Weichenstellungen und Entscheidungen außerhalb des Kontinents zu verringern. Dieses Anliegen findet sich auch im Bericht The Future of European Competitiveness von Mario Draghi, der im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt wurde.
Im Zeitraum von Mitte 2022 bis Mitte 2023 gingen 63 % aller EU-Verteidigungsaufträge an US-Unternehmen, weitere 15 % an andere Nicht-EU-Anbieter3. Die Europäische Verteidigungsindustrie-Strategie beschreibt nun einen Übergang, mit dem Ziel, bis 2030 mindestens 50 % der Verteidigungsausgaben innerhalb der EU zu tätigen – und 60 % bis 20354.
Um diesen Wandel zu beschleunigen, hat die EU im Mai 2025 einen wegweisenden Verteidigungsinvestitionsfonds in Höhe von 150 Milliarden Euro verabschiedet. Der Fonds zielt darauf ab, gemeinsame Beschaffung zu stärken, die industrielle Produktion hochzufahren und europäische Lieferketten zu festigen – ein klares Signal für eine neue Phase langfristigen, koordinierten Aufbaus europäischer Verteidigungsfähigkeiten5.
Geopolitcal Expert View by Nico Fitzroy of Signum Global Advisors
Eine wachsende Unsicherheit über die Rolle der USA als Sicherheitsgarant bewirkt, dass die Verteidigungsausgaben in Europa in den kommenden Jahren insgesamt weiter steigen werden. Auf Länderebene wird das Ausmaß dieser Veränderungen wahrscheinlich von zwei Faktoren abhängen: dem verfügbaren fiskalischen Spielraum und der geografischen Nähe zu Russland.
Während die Nordischen Länder und Baltischen Staaten sowie Länder wie Deutschland und Polen mindestens einen dieser entscheidenden Faktoren in hohem Maße erfüllen, fehlen Ländern in Westeuropa – etwa Italien, Spanien, Frankreich und Belgien – beide Voraussetzungen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Verteidigungsausgaben in Mittel- und Osteuropa (CEE) deutlich stärker steigen und länger auf einem höheren Niveau bleiben werden. Dieser Trend könnte sich noch verstärken, sollte der Ukraine-Konflikt beendet werden (auch wenn dies kurzfristig unwahrscheinlich ist, langfristig aber realistischer wird). In diesem Fall würden die Länder Osteuropas ein weiterhin militarisiertes Russland als noch größere Bedrohung wahrnehmen – insbesondere, wenn Russland seine Ressourcen nicht mehr in der Ukraine binden muss. Gleichzeitig hätten westeuropäische Länder weniger Gründe, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, da sie keine oder weniger Unterstützung für die Ukraine leisten müssten.
Eine zentrale Frage ist, wer von den steigenden Verteidigungsausgaben profitieren dürfte. Das EU-weite SAFE-Programm in Höhe von 150 Mrd. EUR wird voraussichtlich ausschließlich europäischen Herstellern zugutekommen. Dennoch bleibt die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu den USA ein bedeutendes außenpolitisches Ziel vieler CEE-Staaten. Daher ist es wahrscheinlich, dass US-Unternehmen weiterhin von gestiegenen Rüstungsausgaben in Teilen Osteuropas profitieren werden.
Umfragen in Europa zeigen, dass Verteidigungsausgaben bei den Wählerinnen und Wählern keine hohe Priorität genießen. Daher dürften Regierungen versuchen, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben durch gezielte Investitionen in nationale Vorzeigeunternehmen („nationale Champions“) zu rechtfertigen. Unternehmen aus Ländern mit besonders hohen Verteidigungsausgaben – etwa Deutschland – dürften daher überproportional profitieren.
Bevorzugt werden zudem Güter, die einen klaren Nutzen für die nationale Verteidigung bieten (z. B. Drohnen- und Raketenabwehrsysteme) sowie Technologien mit Mehrwert in anderen Bereichen, wie etwa Cyberfähigkeiten und militärische Infrastruktur.
Nico Fitzroy, Partner und Senior Analyst bei Signum Global Advisors
Signum Global bietet erstklassige Research-Dienstleistungen und maßgeschneiderte Beratung für eine exklusive Gruppe von Institutionen und unterstützt seine Kunden dabei, sich in einer Welt zunehmender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten zurechtzufinden.
Mehr als zwei Drittel des gesamten Marktanteils europäischer Rüstungsunternehmen entfallen auf die größten westeuropäischen Märkte
Größte Rüstungshersteller in WesteuropaDie europäische Verteidigungsindustrie ist nach wie vor deutlich kleiner als die der USA, auch da sich die USA seit Jahrzehnten als größte Militärmacht der Welt positioniert haben. In den vergangenen zehn Jahren lag der Anteil europäischer Rüstungshersteller am weltweiten Umsatz zwischen 9 % und 12 %6. Mit steigenden Verteidigungsbudgets und gezielten Investitionen in ganz Europa wird jedoch erwartet, dass dieser Anteil zunimmt. Mehr als zwei Drittel des gesamten Marktanteils europäischer Rüstungsunternehmen entfallen auf die größten westeuropäischen Märkte – darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland7. |
Skalierung und spürbare Nachfrageeffekte brauchen Zeit
Obwohl die Aufrüstung Europas für viele nationale Regierungen und die Europäische Kommission oberste Priorität hat, werden die konkreten Auswirkungen – ebenso wie der daraus resultierende Bedarf an Lager- und Produktionsflächen – erst mit Verzögerung sichtbar.
Der schnellste Weg zur Erhöhung der Produktionsleistung ist der Ausbau bestehender Fertigungsstätten. Gleichzeitig gewinnt die Umnutzung stillgelegter Fabriken, z. B. für die Automobil- oder Schienenfahrzeugindustrie, zunehmend an Dynamik – ein Trend, der sich im gesamten Verteidigungssektor durchsetzt. Diese Maßnahmen dürften mittelfristig (2 bis 5 Jahre) zur Produktionskapazität beitragen und bieten mehrere Vorteile: die Nutzung bestehender Infrastruktur und Logistiknetzwerke sowie den Zugriff auf eine hochqualifizierte und erfahrene Belegschaft.
In 2025 hat diese Initiative sichtbar an Fahrt aufgenommen, wie folgende öffentlich bekanntgegebene Beispiele zeigen:
Viele dieser Zulieferer befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptproduzenten, um eine effiziente und sichere Lieferkette zu gewährleisten.
Rüstungsunternehmen sind derzeit in bestimmten Clustern konzentriert. Die Herstellung von Verteidigungsgütern ist äußerst komplex und erfordert eine Vielzahl spezialisierter Zulieferer. Viele dieser Zulieferer befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptproduzenten, um eine effiziente und sichere Lieferkette zu gewährleisten. Die schnellen Verschiebungen der globalen Spannungen und geopolitischer Strategien werden die Lieferketten in der Rüstungsindustrie zunehmend proaktiv verändern – unter anderem durch den Aufbau größerer Lagerbestände.
Wie der Präsident von BAE Systems Hägglunds sagte:
„Just in time ist tot.“13 Zu den wichtigsten Strategien zur Risikominimierung in der Lieferkette und zur Beschleunigung der Produktion zählen eine stärkere Standardisierung der Endprodukte sowie eine vermehrte Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Diese Maßnahmen sollen die Abhängigkeit von internationalen Komponenten reduzieren und die Resilienz der Branche erhöhen.
Die verteidigungsbezogene Nachfrage wird jedoch voraussichtlich nicht ausschließlich in diesen traditionellen Logistikzentren konzentriert sein.
Je geringer die Sicherheitsanforderungen, der Spezialisierungsgrad und der spezifische Verwendungszweck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Geschäftsabschlüsse zu erzielen.
Investitionen in Verteidigungsfähigkeiten können einen tiefgreifenden Wandel im europäischen Fertigungssektor bewirken – doch die Chancen für Investoren und Entwickler im Bereich Industrie- und Logistikimmobilien (I&L) sind unter der Oberfläche differenzierter.
Grundsätzlich gilt: Je geringer die Sicherheitsanforderungen, der Spezialisierungsgrad und der spezifische Verwendungszweck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Zudem gilt: Je weiter ein Zulieferer vom Endnutzer entfernt ist (z. B. Tier-II- oder Tier-III-Lieferanten), desto größer ist das potenzielle Marktpotenzial.
Insight: Reflexion über die Entwicklungen im Daily BusinessDie europaweit sitzenden GARBE-Businesseinheiten mit Kundenkontakt wurden nach ihren Einschätzungen und Beobachtungen aus Gesprächen mit (potenziellen) Nutzern aus dem Verteidigungsbereich befragt, mit besonderem Fokus auf die Anforderungen an die Immobilien.
|
Deutschlands Gewerbe- und Industrieflächen werden knapp. Laut GARBE Research droht ab 2037 ein Stillstand in Logistikregionen, der Wirtschaft und Standortentwicklung massiv gefährdet. Ohne entsprechende Gegenreaktion könnten Unternehmen abwandern. Wird schnell genug gehandelt, um die drohende Flächenkrise zu verhindern?


GARBE Research legt erstmals eine Analyse vor – und nennt Lösungsansätze.
Seit Jahren ist bekannt, dass es in Deutschland immer weniger verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen (GE- und GI-Flächen) gibt und der Bau von Logistik- und teilweise auch Industrieimmobilien zunehmend schwieriger wird. Der Hauptgrund dafür ist ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage nach solchen Flächen seit dem Jahr 2000, während gleichzeitig immer weniger neue Gebiete ausgewiesen wurden und werden.
Diese Entwicklung ist politisch gewollt: Die Bundesregierung plant den Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu senken und bis 2050 einen Verbrauch von Netto-Null zu erreichen. Hinzu kommt, dass bestehende Gewerbe- und Industrieflächen häufig umgewidmet oder anderweitig genutzt werden, was die Situation zusätzlich verschärft. Diese Entwicklung ist für die deutsche Wirtschaft bedrohlich, da Logistik als Grundlage für Produktion und Konsum gilt – sie bildet die Lebensader der deutschen Wirtschaft.
Um den schleichenden Schwund an Gewerbe- und Industrieflächen genauer zu analysieren, hat GARBE Research eine umfassende Untersuchung auf Basis von Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) durchgeführt. Dabei wurden sämtliche ausgewiesenen GE- und GI-Flächen einbezogen, die grundsätzlich für logistische Nutzungen geeignet sind. Die Analyse umfasst sowohl den allgemeinen Bestand als auch die jährlichen Veränderungen, die durch Zustandsmeldungen nachvollzogen werden können – so flossen sowohl neue als auch wegfallende Flächen in die Untersuchung ein.
Bei den wegfallenden Flächen handelt es sich um alle Flächen, die absorbiert wurden und daher nicht mehr zur Ansiedlung verfügbar sind. Unter die hinzugekommenen Flächen fallen sowohl neu ausgewiesene Gebiete als auch Flächenerweiterungen. Außerdem wurden brachliegende Flächen berücksichtigt, da diese für eine neue Nutzung reaktiviert werden könnten. Zwar kommen durch Insolvenzen oder Umstrukturierungen immer wieder nutzbare Flächen hinzu, doch insgesamt wird das Angebot allmählich kleiner, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Den Schwerpunkt der Studie legten die Analysten von GARBE Research beispielhaft auf Nordrhein-Westfalen. In diesem bevölkerungsreichsten Bundesland ist die Datenlage besonders gut; zudem weist NRW eine der höchsten Infrastrukturdichten Europas auf und ist stark vom Strukturwandel geprägt. Die verwendeten ALKIS-Daten decken den Zeitraum von 2016 bis 2023 ab und wurden auf Basis von Durchschnittswerten dieser Periode hochgerechnet.
Die Analyse zeigt, dass etwa 53 Prozent der bisher ungenutzten GE- und GI-Flächen – rund 800 von insgesamt 1.500 Hektar – über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg ungenutzt geblieben sind. Es ist anzunehmen, dass für diese Flächen dauerhaft keine relevante Nachfrage besteht und sie für logistische Zwecke kaum geeignet sind. Die meisten dieser Flächen weisen strukturelle Standortnachteile auf oder sind schwer zu verwertende Brownfields, deren Erschließung langwierig, komplex und teuer ist. Beispiele solcher Flächen sind ehemalige oberirdische Deponien wie in Werne (40 ha), frühere Versorgungsanlagen wie das Kraftwerk in Voerde (31 ha) oder eine stillgelegte betriebliche Entsorgungsanlage bei Bielefeld (28,5 ha).
Zwischen 2016 und 2023 ist die verfügbare Fläche der GE- und GI-Gebiete in NRW kontinuierlich geschrumpft, mit einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von rund 110 Hektar. Die Fortschreibung zeigt: Bis 2042 wird die Flächenbereitstellung auf null sinken – zu diesem Zeitpunkt heben sich Neuausweisungen und Verbrauch gegenseitig auf. Alle neuen Flächen werden sofort vom Markt aufgenommen. Obwohl 2042 weit entfernt erscheinen mag, bleibt kaum Zeit, diese Entwicklung noch zu beeinflussen, da Planungsprozesse erfahrungsgemäß langwierig sind. Rasches Handeln ist daher unerlässlich, besonders in den Logistikregionen NRWs. Der Handlungsdruck ist hier sogar noch erheblich höher, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.
Abbildung 1: Veränderung der ALKIS-Flächen in NRW, die als GE-/GI-Flächenpotenziale betrachtet werden können (in ALKIS als „Erweiterung, Neuansiedlung“ bezeichnet), sowie der langfristig ungenutzten GE-/GI-Flächen (in ALKIS über einen langen Zeitraum als „außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ bezeichnet)
Ländliche Regionen wie das Münsterland oder das Sauerland sind für logistische Nutzung meist ungeeignet. Daher konzentrierte sich der zweite Analyseschritt ausschließlich auf die sieben Logistikregionen in NRW, wo die Nachfrage nach Flächen besonders hoch ist und Veränderungen daher besonders ins Gewicht fallen. Zwar liegt der durchschnittliche Flächenverbrauch in diesen Regionen zwischen 2016 und 2023 bei 84 Hektar pro Jahr und damit unter dem NRW-Durchschnitt, doch angesichts der begrenzten Gesamtfläche sind die Auswirkungen hier umso dramatischer. Ohne neue Flächen könnte es bereits 2037 zu einem Stillstand kommen, an dem Neuausweisungen die Nachfrage nicht mehr decken.
Dies macht wirtschaftliche Planungen und strategische Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen zunehmend unsicher. Unternehmen könnten daher gezwungen sein, Standorte in andere Bundesländer oder ins Ausland zu verlegen – eine bedenkliche Entwicklung für die Standortpolitik. Zudem wird der Bedarf an Flächen in Zukunft voraussichtlich weiter steigen, da sich durch wirtschaftliche Erholung und strukturelle Treiber wie Social-Commerce sowie neue Produktionskapazitäten für Batterien und andere Technologien zusätzlicher Flächenbedarf ergeben wird. Um diesen künftigen Bedarf zu decken, müssen bereits heute die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.
Abbildung 2: Veränderung der ALKIS-Flächen in NRW, die als GE-/GI-Flächenpotenziale betrachtet werden können (in ALKIS als „Erweiterung, Neuansiedlung“ bezeichnet), sowie der langfristig ungenutzten GE-/GI-Flächen (in ALKIS über einen langen Zeitraum als „außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ bezeichnet)
Um dem drohenden Engpass an Gewerbeflächen zu begegnen, müssten verstärkt neue Flächen ausgewiesen werden. Da dies politisch jedoch nicht angestrebt wird, sollte der Fokus zudem auf der Reaktivierung langzeit-brachliegender Flächen liegen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Logistikregionen. Eine wichtige Maßnahme hierfür wäre der gezielte Ausbau der Infrastruktur, um abgelegene Grundstücke besser anzubinden und ihre Standortnachteile zu verringern. Zudem sollte das Engagement in Brownfield-Projekte gestärkt werden, da viele Akteure derzeit durch die hohen Kosten und die komplexe Umsetzung solcher Vorhaben eher abgeschreckt sind. Ein ‚Weiter so‘ kann keine Option sein, wenn der drohende Engpass und die Gefahr einer Abwanderung von Unternehmen verhindert werden sollen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage mit sinkender Nachfrage und leicht steigenden Leerständen drängt sich die berechtigte Frage auf, ob das Thema Flächenmangel überhaupt akut ist. In unserer Wahrnehmung ist es aber gerade richtig darüber zu sprechen. Denn die langen Phasen bei Baurechtschaffung und Planung sind einer der Hauptgründe für die Trägheit der Immobilienmärkte und damit Ursachen des drohenden Schweinzyklus. Aus diesem Grund werden wir im ersten Halbjahr 2025 ein Webinar dazu abhalten und dieses Thema mit den wichtigsten Stakeholdern diskutieren. Bleiben Sie am Ball!
Der E-Commerce verbuchte im letzten Jahrzehnt deutliche Zugewinne, wobei auf das Rekordwachstum während der Pandemie eine ruhigere Phase am Nach-Corona-Markt folgte. Obwohl das Gesamtwachstum im Online-Handel in den letzten Jahren nachgelassen hat, verzeichneten immerhin Trends wie Fast Fashion und Social Commerce Zuwächse und erforderten entsprechend reaktionsschnelle Lieferketten samt entsprechender Logistikpräsenz. Da demnächst mit einem erneuten Aufschwung zu rechnen ist, gilt es jetzt, die derzeitige und künftige Lage in diesem dynamischen Sektor zu beobachten.
Das Wachstum im E-Commerce hat nach dem Stillstand der vergangenen Jahre in 2024 wieder angezogen.Durch die Pandemie beschleunigte sich das Wachstum des Online-Handels um ca. 2-3 Jahre, gefolgt von einer vorübergehenden Pause, als sich Verbraucher nach Aufhebung der Beschränkungen wieder anderen Handelskanälen und Freizeitaktivitäten zuwendeten. Dies bedeutete für den E-Commerce zwar keinen längeren Abschwung, doch die Umsätze stiegen in mäßigerem Tempo. Im Juli 2024 übertrafen die Online-Umsätze in den EU-8-Staaten (gewichteter Durchschnitt) erstmals selbst die Spitzenmonate zu Corona-Zeiten 1. Zu den bemerkenswerten Folgen der Pandemie gehört die beschleunigte Einführung neuer Geschäftsfelder, wie dem Online-Lebensmittelhandel, sowie der Umstand, dass selbst ehemals skeptische Verbraucher zum Online-Einkauf übergingen. Diese neuen Shopping-Gewohnheiten und -Trends werden sich vermutlich weiter etablieren. |
Anmerkung: EU-8 bezeichnet den Gesamtwert für UK, DE, FR, NL, PL, ES, IT, SE. Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Internet-Gesamtumsatzes im Jahr 2023 |
Zu den wachstumsstarken Segmenten gehört Fast Fashion, also trendige Billigmode, die von Unternehmen wie Shein angeboten wird. So ist Shein binnen kurzer Zeit zu Europas größtem Online-Modehändler geworden, und übertraf 2023 mit seinem Nettoumsatz das zweitplatzierte Unternehmen H&M2 um das Doppelte. Insgesamt war die Fast-Fashion-Branche in den letzten Jahren von starkem Wachstum geprägt und dürfte auch weiterhin expandieren. Für Europa wird bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 %3 gerechnet. Um diese Zuwächse zu ermöglichen, setzen außereuropäische Fast-Fashion-Anbieter inzwischen auf den Aufbau einer europäischen Infrastruktur, anstatt sich allein auf Luftfracht zu verlassen. Aufgrund offener Fragen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Steuerregeln und Arbeitsbedingungen wächst jedoch gleichzeitig in Öffentlichkeit, Politik und Medien die Kritik an der Niedrigpreisstrategie der Fast-Fashion-Händler.
Ein weiteres rasch wachsendes Segment ist der so genannte Social Commerce, bei dem Produkte oder Dienstleistungen direkt auf Social-Media-Plattformen angeboten werden, und zwar durch die Verknüpfung von sozialen Medien wie TikTok oder Instagram mit Online-Händlern. Auch in Europa wird mit starkem Umsatzwachstum beim Social Commerce gerechnet, wobei CAGR-Prognosen einen Anstieg um 20,1 % zwischen 2024 und 20294 vorhersagen.
Die Segmente Fast Fashion und Social Commerce haben die Trendzyklen verkürzt. Sie konzentrieren sich auf die Agilität von Lieferketten und Logistikimmobilien, etwa indem sie Produkte näher am Verbraucher positionieren (wie im Fall der Logistikobjekte von Shein in Frankfurt und Breslau) und/oder die Produktion in europäische Nachbarländer verlagern. Jüngste Fallstudien zeigen zunehmendes Interesse europäischer Modemarken an Ländern wie der Türkei, Tunesien und Marokko, die sich aufgrund ihrer Nähe zum europäischen Markt und kürzeren Vorlaufzeiten besonders gut als Produktionsstandorte eignen. Getrieben wird dieser Wandel im Fast-Fashion-Segment von der Notwendigkeit, die Logistikkosten zu senken, die Markteinführung von Produkten zu beschleunigen und nachhaltigere Geschäftspraktiken umzusetzen.
Unternehmen, die zu Corona-Zeiten rasantes Wachstum erlebten, haben mittlerweile ihre Zielgebiete verkleinert.
Für manche Segmente ist das Umfeld in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Ein Beispiel dafür wäre der Quick Commerce, bei dem die Lieferung geringer Warenmengen über lokale Fulfillment-Center binnen 10-60 Minuten angeboten wird. Unternehmen, die zu Corona-Zeiten rasantes Wachstum erlebten, haben mittlerweile ihre Zielgebiete verkleinert, so etwa Zapp (Rückzug aus Frankreich und den Niederlanden) und Gorillas (Rückzug aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien). Derzeit wird das Wachstumspotenzial vor allem durch Herausforderungen wie Skalierung, Rentabilität, Wettbewerb und behördliche Auflagen gefährdet.
Nach kurzem Stillstand gegen Ende der Pandemie deuten erste Zeichen nunmehr auf eine Rückkehr zu Umsatzzuwächsen auf Vor-Corona-Niveau im Laufe des Jahres 2024 hin. Die Auswertung von Angaben eines Panels von 5 Mio. Online-Kunden ergibt für zehn EU-Staaten einen Anstieg des E-Commerce-Gesamtwerts (+11 % gegenüber Vorjahr) und des -Gesamtvolumens (+19 % gegenüber Vorjahr)5.
Eine weitere Variable, die auf einen bevorstehenden Wendepunkt im E-Commerce hindeutet, ergibt sich aus der Analyse der Transportströme im Umfeld der Amazon-Lager in den drei größten europäischen E-Commerce-Märkten. Der Verkehrsfluss innerhalb eines Radius von 2,5 km um die (insgesamt 51) Amazon-Lager in Großbritannien, Deutschland und Frankreich erreichte 2024 zunächst einen Tiefstand und begann sich dann sukzessive zu erholen. Die von Kania Advisors bereitgestellten Vorhersagedaten basieren auf den im Umfeld von E-Fulfillment-Centern erfassten Verkehrsbewegungen und sind ein Frühindikator für wieder anziehende Online-Handelsumsätze. Steigendes Verkehrsaufkommen verweist schon frühzeitig auf Trends, die sich später auch in den amtlichen monatlichen Umsatzzahlen niederschlagen und schließlich auch in den Umsatzzahlen für Logistikflächen, die als nachlaufende Statistiken gelten können.
Auf der Landesebene weist Deutschland einen stärkeren Zuwachs an Verkehrsaufkommen als Großbritannien und Frankreich auf, und das ungeachtet seines derzeit schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes. Allgemein erreichte das Aktivitätslevel Ende 2023 und Anfang 2024 einen Tiefstand (siehe Abbildung 2). In den letzten Monaten dagegen lag das Verkehrsaufkommen marginal über dem Vor-Corona-Stand. Der jüngste Anstieg stellt ein frühes Anzeichen für eine Rückkehr zum historischen Wachstumskurs dar.
Auf der Ebene der Einzelhändler deuten erste Anzeichen auf steigende Flächenumsätze bei Logistikimmobilien im Verlauf der nächsten Quartale hin. In den USA, wo die Geschäfte von Amazon bereits an Fahrt gewonnen haben, ist dieser Prozess längst in Gang. Dagegen lässt die Belebung in Europa noch auf sich warten. Während der Pandemie kamen Amazon ebenso wie andere Online-Händler dem Anstieg der Nachfrage (Umsatz) durch Anmietungen zuvor und müssen die angemieteten Flächen nun erst mal absorbieren. Allerdings sind die Online-Umsätze von Amazon in Europa im Jahresverlauf 2024 rascher angestiegen als der Flächenbestand des Unternehmens, was eine Rückkehr zum historischen Trend nahe legt6. Auch wenn die Differenz zwischen Umsatz und Flächenzuwachs aktuell größer ist als je zuvor, dürfte sich die Lücke rasch schließen und der Flächenbedarf entsprechend ansteigen.
Zweistelliges Wachstum in den kommenden Jahren zu erwarten.Für die acht von Green Street/Oxford Economics/CBRE beobachteten Märkte (EU-8) lässt die jüngste E-Commerce-Prognose (im Oktober 2024 veröffentlicht) die Rückkehr zu zweistelligen Umsatzzuwächsen in den Jahren 2025 bis 2027 erwarten. Dies würde in etwa der seinerzeit als stark eingestuften Wachstumsdynamik vor Corona entsprechen. Verglichen mit dem stationären Einzelhandel wachsen die Online-Umsätze schneller als vorhergesagt: Für die Jahre 2024 bis 2028 stehen einem kombinierten jährlichen Durchschnittswachstum (CAGR) von 10,1 % im E-Commerce 2,3 % im stationären Handel gegenüber (siehe Abbildung 3). |
Die Marktdurchdringungsquote geht seit 2022 wieder nach oben und soll laut Prognosen bis Jahresende bei 17,4 % liegen. Damit würde sie das Pandemieniveau vom Jahresende 2020 um 10 BP übertreffen, Zudem dürfte sie in den EU-8-Ländern6 bis Ende 2028 auf 21,9 % ansteigen.
In Bezug auf Akzeptanz und Marktdurchdringung waren Länder wie Großbritannien und die Niederlande schon immer führend und werden dies auch bleiben, wie sich aus Abbildung 4 ergibt. Großbritannien soll laut Prognose bis Ende 2028 auf eine Marktdurchdringung von 32 % kommen, was nicht nur die höchste Quote in Europa wäre, sondern auch einer der höchsten weltweit6 . Im Zeitraum 2024-2028 soll der Anstieg der Marktdurchdringung laut Prognose am stärksten in Polen (+7,1 % auf 23,5 %), Spanien (+7,1 % auf 17,7 %) und den Niederlanden (+6,9 % auf 27,5 %) ausfallen.
Abbildung 4: Marktdurchdringungsquote im Vergleich
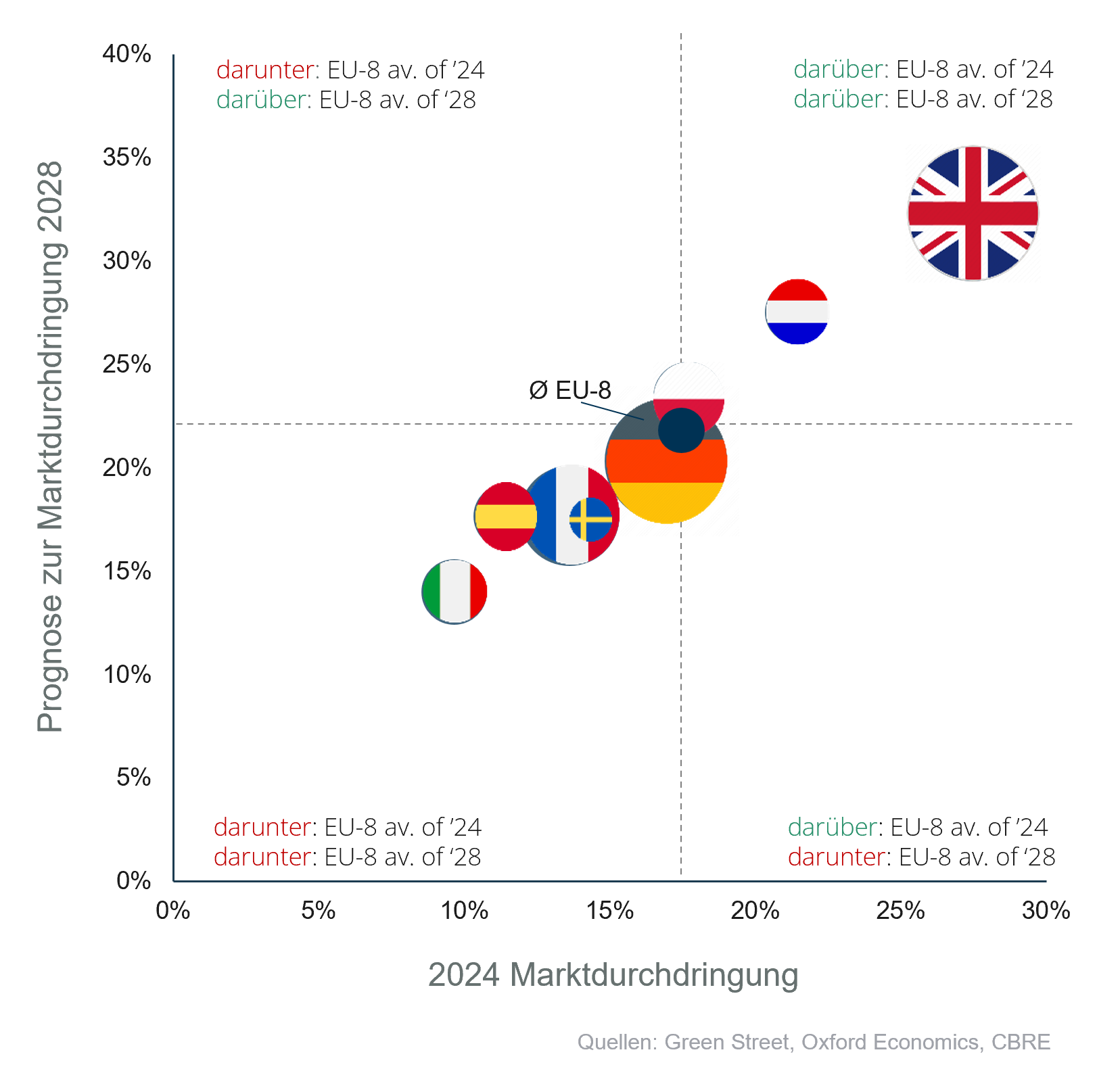
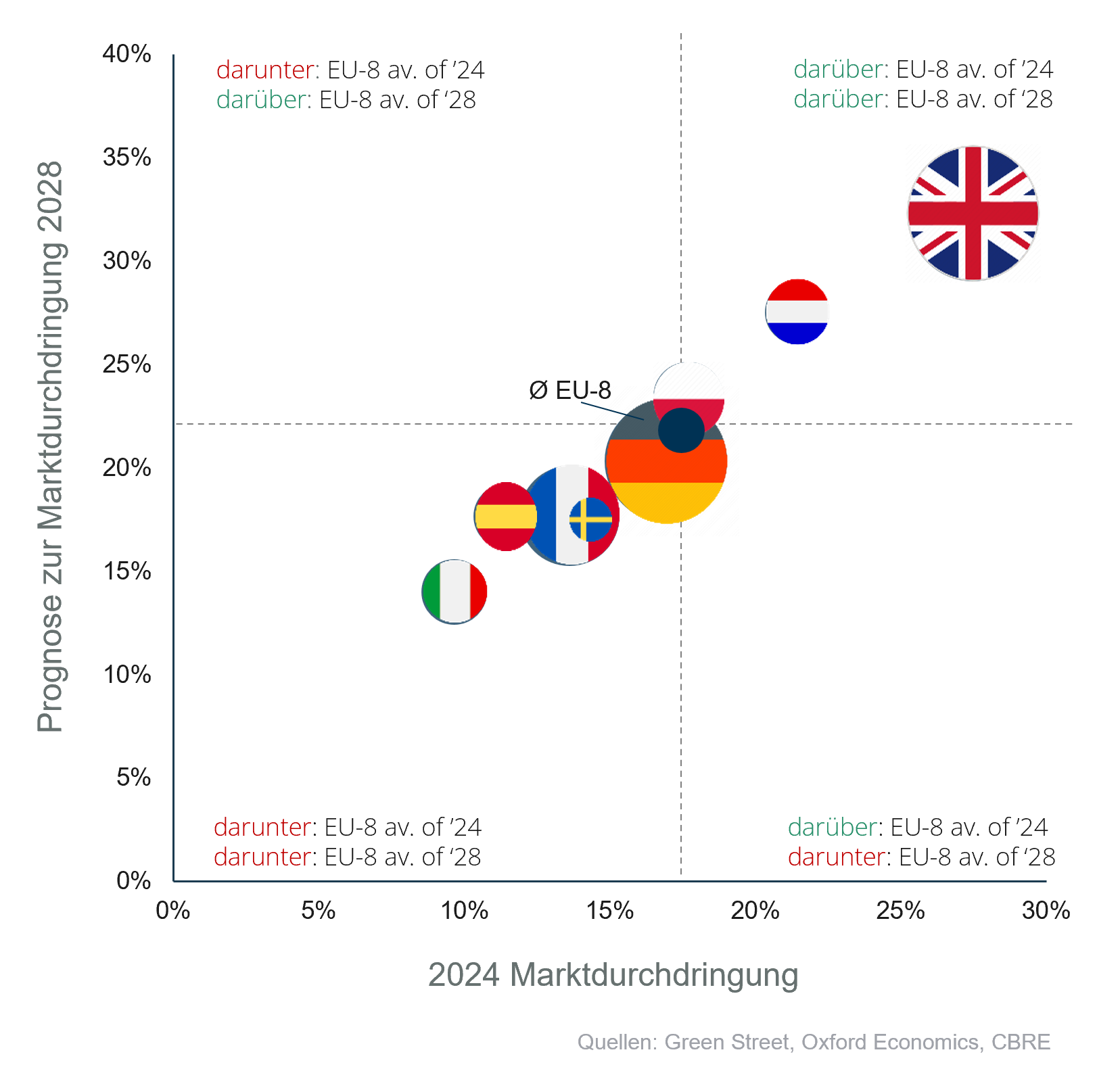
Laut Prognose wird der Online-Handel zwar zu seinem Wachstumskurs der Vor-Corona-Zeit zurückfinden, doch die Gruppe der Wachstumssegmente ist nicht mehr die gleiche und auch das Konsumverhalten hat sich weiterentwickelt. Daher dürfte sich der Schwerpunkt hin zu einer dezentralen Lieferkette mit kleineren Außenlagern nahe Ballungszentren und Logistik-Hotspots verschieben. Nachstehend aufgeführt ist eine Auswahl von Faktoren, die den Übergang prägen.
| Kosteneffizienz: 50 %6 Lieferkettengesamtkosten in der Endzustellung |
Auf die Endzustellung in der E-Commerce-Lieferkette entfallen mindestens 50 % der Gesamtlieferkettenkosten. Die Lagerhaltung näher am Endkunden anzusiedeln spart Fahrzeit, Treibstoff, Lohnkosten und optimiert die Nutzung der Fahrzeuge, ist aber mit höheren Mietkosten für Logistikimmobilien verbunden.
|
| Planbarkeit: 90-95 %7 Gesicherte Warenverfolgung vor der Einbuchung ins Lager |
In Antwort auf den Kundenwunsch nach flexiblen und genauen Zustellzeitpunkten setzen Unternehmen wie DHL auch KI ein, um Zustellzeiträume mit einer Genauigkeit von 90-95 % vorherzusagen. Kunden erhalten somit fortlaufend aktualisierte Zustelltermine und können Anpassungen in Echtzeit vornehmen, was für mehr Zufriedenheit und einen Rückgang vergeblicher Zustellversuche sorgt. Eine höhere Planbarkeit könnte letztendlich zu einer höheren Gebäudeeffizienz führen und sollte daher näher am Endkunden passieren.
|
| Genauigkeit: 60 %8 Für europäische Händler die oberste Priorität bei der Endzustellung |
Seit dem Ende der Pandemie messen Händlern bei der Endzustellung Genauigkeit mehr Bedeutung bei als der Lieferfrist, dem zweitwichtigsten Erfolgsfaktor. Dieser Anspruch wird insofern immer schwieriger zu erfüllen sein, als mit einer Verdoppelung des Marktvolumens in der Endzustellung („Last Mile“) in den Jahren 2022 bis 2027 gerechnet wird.
|
| CO2-Fußabdruck Das 1,5- bis 2,9-fache9 Vergleich von Treibhausgasemissionen beim stationären und Online-Handel in Europa |
Der Einkauf im stationären Einzelhandel verursacht 1,5 bis 2,9 Mal mehr Treibhausgasemissionen als der Online-Einkauf. Dies erklärt sich durch das effizientere Transportwesen (Lieferfahrzeuge stoßen im Vergleich zu PKW 4 bis 9 Mal weniger Schadstoffe aus) sowie einen geringeren Flächenverbrauch und niedrigeren Gebäudeenergiebedarf.
|
| Frischware: 33 %10 Gemeldeter Online-Umsatz europäischer Verbraucher bei Frischwaren |
Dieser Wachstumstrend veranschaulicht die Notwendigkeit, Lieferketten und Distributionszentren näher am urbanen Raum anzusiedeln, um die Frische und fristgerechte Lieferung verderblicher Waren zu gewährleisten.
|
| Sperrigere Artikel: 26 %11 Umsatz europäischer Verbraucher bei Möbeln, Innenausstattung, Gartenbedarf in den letzten 3 Monaten |
Am Trend hin zu sperrigen Artikeln wird deutlich, wie ungeeignet ein einziger zentraler Distributionspunkt sein kann, da der Transport von Großgütern über weite Entfernungen unwirtschaftlich ist.
|
Der Online-Handel hat die Ruhepause nach dem Ende der Pandemie überwunden.
Erste Anzeichen einer Expansion lassen eine allmähliche Rückkehr zu Wachstumsquoten auf Vor-Corona-Niveau erwarten. Getrieben wird die Erholung vor allem von dynamischen Segmenten wie Fast Fashion und Social Commerce. Der Aufwärtstrend spiegelt sich in Vorhersagedaten wie etwa dem gestiegenen Fahrzeugverkehr im Umfeld von Amazon-Lagern und dem jüngsten Anstieg des monatlichen Online-Umsatzes. Die Branche bewegt sich in Richtung eines dezentralen Logistikmodells, das den Schwerpunkt auf die Nähe zum urbanen Raum und Logistik-Hotspots legt, um Erwartungen wie Genauigkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit besser gerecht zu werden.
Es gibt keinen passenderen Rahmen, um diese Frage zu erörtern, als die GARBE Vordenker Konferenz, die bereits zum dritten Mal stattfand und von Tanja Kewes moderiert wurde. Rund 140 Investoren, Bankvertreter, Dienstleister und Geschäftspartner waren der Einladung gefolgt, um zu diskutieren, zu berichten, miteinander in den Dialog zu gehen und voneinander zu lernen.
Nach der Eröffnungsrede von Christopher Garbe, erwarteten uns zahlreiche Impulsvorträge, Panel-Diskussionen und spannende Breakout-Sessions.
Am Vormittag lag der Schwerpunkt bei der Paneldiskussion auf dem Thema Change Management. Im Fokus stand, wie Unternehmen in Zeiten des Wandels ihre Zukunftsfähigkeit sichern können. Eins ist hier deutlich geworden: „Hoffen ist keine Option!“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
In den GARBE Deep Dive Sessions kamen die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen, um aktuelle und relevante Themen aus dem GARBE Universum intensiv zu diskutieren. Auf der Agenda standen unter anderem die Flächensicherung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Attraktivität von Nahversorgungszentren als Investment, die Herausforderungen der Integration von Photovoltaik in Gewerbe- und Industriegebäuden sowie die Potenziale zur Umnutzung von Büroflächen, die den realen Anforderungen der Entwickler begegnen müssen. Diese Themen wurden nicht nur oberflächlich angeschnitten, sondern in ihrer ganzen Tiefe analysiert und debattiert, was zu wertvollen Einblicken und konkreten Handlungsansätzen führte.
Der zweite große Themenschwerpunkt der Konferenz widmete sich den Arbeitswelten der Zukunft. Die Diskussionen gingen weit über die allgegenwärtige Frage „Homeoffice oder Büro?“ hinaus und beleuchteten tiefgreifende Thesen und Zukunftsszenarien.
Die Teilnehmenden setzten sich intensiv mit den Veränderungen auseinander, die die Arbeitswelt in den kommenden Jahren prägen werden und entwickelten neue Perspektiven auf die Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.


Zum Abschluss der Konferenz sorgte eine mitreißende Rede von Claus Kleber für einen würdigen Höhepunkt. Kleber beschrieb die aktuelle Zeitenwende als einen Crashtest für den Westen, was die Teilnehmenden zum Nachdenken anregte und die Ernsthaftigkeit der globalen Herausforderungen unterstrich. Ein packendes Finale, das die Konferenz mit einer Fülle neuer Erkenntnisse und wertvoller Impulse abrundete.

Geschäftsführer von GARBE Industrial Real Estate
5 Fragen an unseren Experten
Die Nachfrage nach Logistikflächen in Europa übersteigt das Angebot deutlich. Wir haben Jan Philipp Daun, Geschäftsführer von GARBE Industrial Real Estate, nach den Gründen gefragt und mit ihm über niedrige Leerstandsquoten, starke Regulierung und große Potenziale auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt gesprochen.
Die Nachfrage nach Industrie- und Logistikimmobilien (I&L) in Europa übertrifft das Wirtschaftswachstum erheblich. Was sind die Gründe dafür?
Zwar unterstützt das Wirtschaftswachstum die Entwicklungen auf den Immobilienmärkten. Im Bereich I&L sind aber vor allem strukturelle Faktoren relevant. Sie schaffen eine robuste Nachfrage, die weitgehend unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Dynamik ist. Zu diesen strukturellen Faktoren zählen zum einen der steigende Bedarf an sogenanntem Nearshoring, also der Ausbau von Produktionsstandorten im benachbarten Ausland. Zum anderen sind die europäischen Märkte historisch unterversorgt. Denn die paneuropäischen Netze und die Institutionalisierung der Anlageklasse I&L entstanden erst in den frühen 2000er Jahren mit dem Schengener Abkommen. Vor allem Mittel- und Osteuropa sowie die südeuropäischen Länder zeigen derzeit einen hohen Bedarf an I&L. Dieser Trend dürfte sich auch künftig fortsetzen.
Der europäische Markt hat hohe Angebotsbarrieren und ist stark reguliert. Herausforderung oder Chance?
In ganz Europa sind Grundstücke knapp geworden, insbesondere in der Nähe der großen Zentren. Und wenn ein Bauherr ein Grundstück erworben hat, warten komplexe Regulierungsverfahren auf ihn. Nach Angaben der Weltbank dauert die Erteilung einer Baugenehmigung in den zehn Ländern, in denen GARBE tätig ist, durchschnittlich über 170 Tage. Zum Vergleich: In den USA liegt der Durchschnitt bei lediglich 81 Tagen. Dort geht es also mehr als doppelt so schnell. Entwickler in Europa stellt das natürlich zunehmend vor Herausforderungen. Gleichzeitig führen die begrenzte Flächenverfügbarkeit und die langwierigen Regulierungsverfahren zu Angebotsengpässen, die eine niedrige Leerstandsquote nach sich ziehen und das Risiko einer Überversorgung verringern.
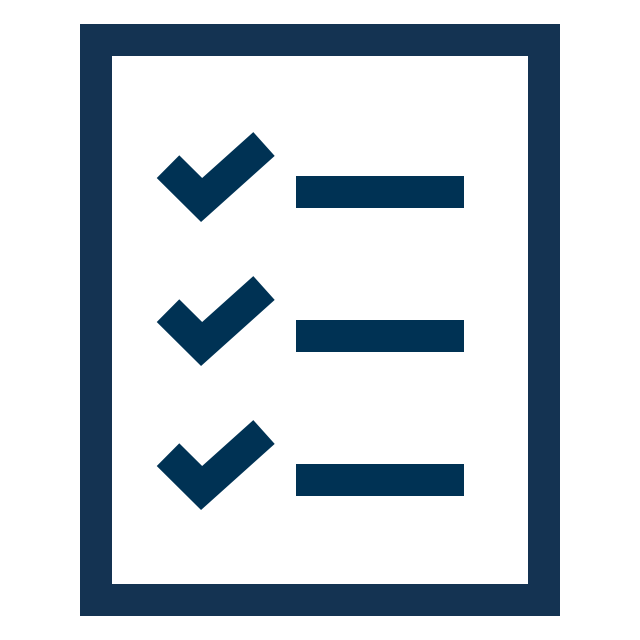
Was spricht aus Investorensicht noch für ein Engagement auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt?
Der europäische Markt gilt – verglichen mit anderen großen Märkten – als relativ risikoarm. Der Blick in die USA verdeutlicht das: Während in den USA im Jahr 2023 rund 84 Prozent der Fertigstellungen als spekulativ galten, lag der Anteil spekulativer Bauten am Gesamtbauvolumen in den wichtigsten europäischen Märkten deutlich darunter: In Italien beispielsweise bei 64 Prozent, in den Benelux-Ländern und Deutschland bei knapp 40 Prozent. Dieser geringere Anteil an spekulativen Investments ist unter anderem auf eine höhere Sicherheitsorientierung in Europa zurückzuführen, aber auch darauf, dass „Built-to-Suit“-Projektentwicklungen (BTS) in den europäischen Staaten sehr viel häufiger vorgenommen werden als in vielen anderen Ländern. BTS bedeutet, dass man eine Immobilie „nach Maß“ entwickelt: Das Objekt wird also direkt auf die Bedürfnisse des Mieters zugeschnitten. Für Unternehmen ist dieser Ansatz attraktiv, weil die Immobilie allen, teils sehr individuellen, Anforderungen entspricht. Auf Investorenseite sprechen die geringen Risiken bei einer vergleichsweise hohen Rendite für BTS.
Aus Investorensicht gibt es in Europa also noch viel Spielraum für Mietsteigerungen.
Wie schätzen Sie das Potenzial für Mietwachstum in Europa ein?
Das Potenzial ist erheblich. In den vergangenen Jahren sind die Mieten zwar gestiegen, aber langsamer und später im Zyklus als in den USA, wo sie mehrere Jahre hintereinander zweistellig gewachsen sind. In vielen europäischen Märkten liegen die inflationsbereinigten Mieten noch immer unter dem Niveau von 2006, durchschnittlich etwa zehn Prozent darunter. In den USA hingegen liegen die Mieten etwa 45 Prozent über dem damaligen Niveau. Aus Investorensicht gibt es in Europa also noch viel Spielraum für Mietsteigerungen, bevor die Märkte überteuert werden. Aus Nutzersicht wiederum machen die Immobilienkosten einen geringen Anteil der Kernkosten in der Lieferkette aus und dürften auch künftig nicht zu stark ins Gewicht fallen. Insgesamt entfallen auf die Fixkosten inklusive Miete nur etwa drei bis sechs Prozent der Kernkosten.

Welche Entwicklungen werden auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt künftig eine besondere Rolle?
Ein entscheidender Faktor ist das zunehmende Augenmerk auf ESG, sowohl aus Investorensicht als auch auf Seiten der Nutzer. Europa gilt in diesem Bereich als einer der globalen Vorreiter. Das betrifft nicht nur den Neubau, sondern auch die Bestandsentwicklung, bei der „Manage to Green“- und „Manage to Social“-Maßnahmen eine immer wichtigere Rolle spielen. Bei Erstgenanntem geht es vor allem darum, den CO2-Fußabdruck der Immobilie zu verringern und verantwortungsvoll mit der Primärenergie umzugehen. Bei Letztgenanntem darum, das Wohlbefinden der Menschen in der Immobilie zu steigern. Aus Nachfragesicht sind das bereits erwähnte Nearshoring und der steigende Bedarf an effiziente Lösungen für die Gewährleistung der Lieferketten weitere wichtige Faktoren. Der Onlinehandel hat nach der COVID-19-Pandemie eine gewisse Korrektur erfahren. In den kommenden Jahren wird hier aber wieder ein kontinuierliches Wachstum erwartet. Auf der Angebotsseite werden regulatorische Vorgaben das Risiko eines Überangebots auch künftig klein halten und Marktstabilität und Mietwachstum begünstigen.
EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung und CRREM-Pfad sind nur einige Regelwerke, die eingeführt wurden, um die Nachhaltigkeitsprinzipien der Vereinten Nationen (UNPRI) im Bereich der Immobilienwirtschaft umzusetzen.
Eine ESG-Strategie ist daher Kernbestandteil in den Strategiepapieren der Marktakteure. Zudem legen vor allem europäische Investoren zunehmend Wert auf die Einhaltung der ESG-Kriterien.
Eine ganze Reihe an Bewertungen wurden entwickelt, um die Ziele messbar zu machen. Einen guten Überblick bietet die von PRI, INREV und ULI gemeinsam erstellte Übersicht „Mapping ESG – A Landscape Review of Certifications, Reporting Frameworks and Practices“.
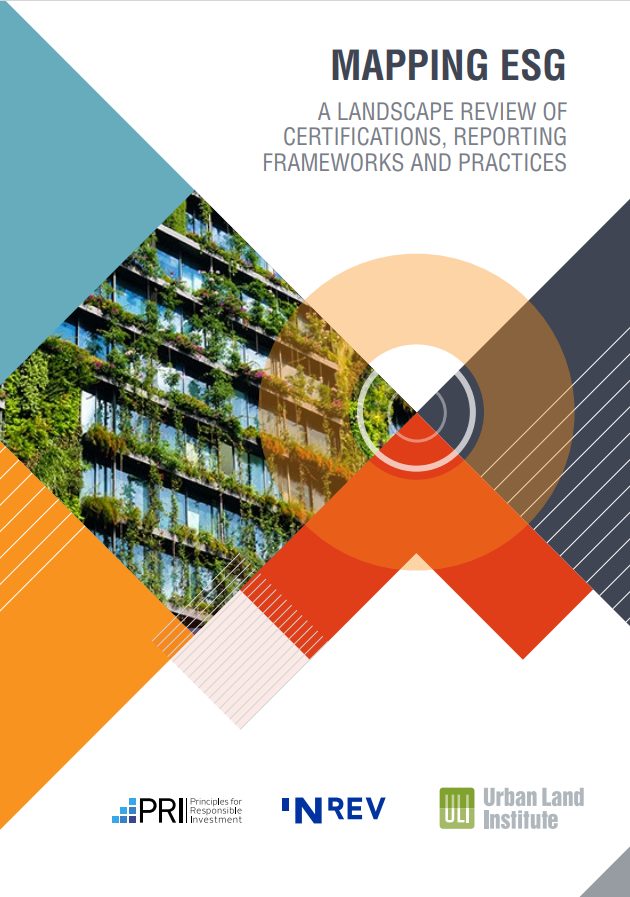
Diese hat die weltweit gängigen Systeme gescreent und die gängigen Analysen gegenübergestellt. Auffällig, aber nicht überraschend, ist, dass ein Großteil der Verfahren die ökologische Nachhaltigkeit auswertet (E). Etwas seltener wird auch die Unternehmensführung (G) analysiert. Die Bewertung sozialer Aspekte (S) führt bislang ein Nischendasein.
Das „S“ in ESG führt Nischendasein, hat aber eigentlich einen großen Wert, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.
Während ökologische und Governance-Aspekte gut zu beschreiben und bewerten sind, ist die soziale Ebene verhältnismäßig komplex. Komponenten, die sich auf den Faktor Mensch an seinem (Logistik)-Arbeitsplatz beziehen, sind komplex. Sie beziehen sich auf:
Abbildung 1: Titelblatt der Vergleichsstudie „Mapping ESG“ von PRI, INREV und ULI
Das Wohlbefinden von Mitarbeitern in den Immobilien zu steigern, ist ein Kernelement der ESG-Prinzipien. In einigen Assetklassen, z. B. Büro und Wohnen, gibt es durchaus einige Standards oder Herangehensweisen wie das „Wellbeing“-Zertifikat. Bei Logistikimmobilien sind diese Standards bisher spärlich definiert. Dabei gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die sozialen Standards zu heben. Gesundheitlicher Arbeitsschutz, um die körperlichen Belastungen zu reduzieren oder soziale „In-House-Angebote“, um die periphere Lage der Immobilien gegenüber Büroimmobilien auszugleichen, sind Ansatzpunkte. Allerdings sind die spezifischen Bedürfnisse dieser Mitarbeiter bislang nicht ausreichend transparent aufgearbeitet wie in anderen Berufsgruppen. Zwar gibt es dezidierte Anforderungen aus ESG-Gesichtspunkten, die Standards sind hier aber ggf. höher formuliert, als mitunter tatsächlich benötigt.
Die Aufwertung der Aufenthaltsqualität rund um die Halle kann zu einem höheren Wohlbefinden der Mitarbeiter der Logistikimmobilie führen. Nicht immer sind dies Maßnahmen, die sich direkt an die Menschen richten.
Diese Maßnahmen steigern allesamt die Aufenthaltsqualität, auch wenn es hierfür noch keine standardisierten messbaren Faktoren gibt.
Neben Logistikzentren selbst sowie ihrem unmittelbaren Standort, wird die Qualität des Standortes auch durch das erweiterte Umfeld der Halle bestimmt. Die Wertigkeit des Arbeitsplatzes bemisst sich hier durch Vielfalt, Qualität und Erreichbarkeit von Angeboten, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Durch die häufig periphere Lage von Logistikzentren in Gewerbe- und Industriegebieten ist der Arbeitsweg meist weiter als für andere Berufstätige. Zudem arbeiten Logistikmitarbeiter häufig in Schichtsystemen und haben dadurch weitere Nachteile. Um ein langfristig nachhaltiges Investment zu gewährleisten, ist es daher notwendig, Faktoren zu bestimmen, die langfristig (nahezu) unveränderbar sind. Hierzu gehört die Anbindung an den ÖPNV, die Möglichkeiten die täglichen Bedürfnisse zu erfüllen – z. B. mit Mittagstischen oder Restaurants/Imbissen/Kantinen. Auch Lebensmittelgeschäfte, Drogerien oder gar Kinderbetreuung sind wichtig, um Logistikmitarbeitern auch vor diesem Hintergrund ein sozial ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitsstelle und Lebensqualität zu ermöglichen.
Die genannten Aspekte stehen nur für einige der Komponenten, um die soziale Nachhaltigkeit zu bestimmen. Wichtig ist, diese nachvollziehbar zu quantifizieren und keine subjektiven Einschätzungen zu verwenden. Dies wird besonders dann wichtig, wenn die Prüfung regelmäßig durchgeführt werden soll. Zwar unterliegen diese Faktoren keinen regelmäßigen, starken Veränderungen. Im Zuge eines typischen Investmentzyklus kann jedoch neue Infrastruktur entstehen. Auch Versorgungsmöglichkeiten kommen hinzu oder werden eingestellt. Immobilienstandorte, die beim Ankauf über eine hohe soziale Standortqualität verfügten, können im Zeitverlauf von beispielsweise zehn Jahren schleichend und graduell an Qualität verlieren. Hier müssen rechtzeitig Strategien zum Umgang entwickelt werden. Mit passenden Geodaten und Auswertungssystemen ist dies heutzutage einfach und schnell umsetzbar – entsprechendes Know-how vorausgesetzt. Zur Quantifizierung der sozialen Aspekte werden zumeist die fußläufige Distanz, Quantität und Qualität der Angebote um einen Radius zur Logistikhalle ermittelt. Ein Bewertungsschema kann daraus einen Wert ohne jegliche subjektive Verzerrung berechnen.
Die soziale Standortkomponente steht bei vielen Investoren bislang nicht ganz oben auf der Agenda, vielleicht auch, weil hier kaum Bewertungsansätze vorhanden sind. Ein Ausblenden dieses Faktors kann sich jedoch als nachteilig herausstellen, denn eine vollständige ESG-Strategie schließt auch die Sozialkomponente bewusst mit ein. Bei Logistikimmobilien bedeutet dies auch zwingend die Standortqualität vor dem Hintergrund der Qualität für die Mitarbeiter – gerade vor dem stetig an Bedeutung gewinnenden Fachkräftemangel.
Da hier nur wenige Ansätze vorhanden sind, engagiert sich GARBE gemeinsam mit anderen Marktakteuren in der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung gif e. V. zur Definition eines Standards in der Herangehensweise. Gleichzeitig werden die Ansätze bereits in hauseigenen Tools getestet und entwickelt.
Man könnte denken, dass Immobilien weltweit mehr oder weniger der gleichen grundlegenden Dynamik unterliegen.
Bei näherer Betrachtung der beiden größten Märkte der Welt (USA und Europa) ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Dabei zeichnet sich der europäische Markt durch strukturelle Nachfragetreiber und besonders hohe Angebotsbeschränkungen aus. In der neuesten Auflage von „Why invest in …?“ stellen wir Schlüsselmerkmale vor, durch die sich der europäische Markt abhebt.
Doch eine nähere Betrachtung der beiden weltgrößten Logistikimmobilienmärkte bringt tiefer liegende Unterschiede ans Licht. Im vorliegenden Beitrag geht es um die spezifischen Merkmale des europäischen Marktes im Vergleich zum US-amerikanischen, der als führender und etabliertester Markt der Welt gilt.
Konjunkturelles Wachstum kommt allen Immobilienbereichen zugute, so auch dem Logistiksegment. Wie sich jedoch aus Abbildung 1 ergibt, lagen die Zuwächse an belegten Objekten in den Jahren 2013 bis 2023 in neun europäischen Ländern deutlich vor dem realen BIP-Wachstum. Das Wirtschaftswachstum belief sich in diesem Zeitraum auf ca. 14 %, wohingegen sich der Bestand an belegten Flächen fast verdoppelte. In den USA weisen diese beiden Kennwerte eine engere Korrelation auf. Das überdurchschnittliche Wachstum an Logistikflächen im Vergleich zum europäischen BIP-Wachstum erklärt sich durch die Bedeutung der strukturellen Treiber, die für krisenfeste Nachfrage sorgen. Zu diesen strukturellen Treibern gehören auch der zunehmende Nearshoring-Bedarf und die Unterversorgung bestimmter Märkte.
Anmerkung: Die EU-Statistik basiert auf den nationalen Leerstandsquoten von 9 Ländern (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Spanien und Italien).
Aus Abbildung 2 geht hervor, dass die europäischen Märkte generell über einen unzureichenden Bestand an Logistikflächen verfügen. Die strukturelle Nachfrage ist auf eine zunehmende Etablierung des Segments zurückzuführen. Die europäischen Märkte sind auch deswegen unterversorgt, da sich paneuropäische Netzwerke erst im Zuge des Schengen-Abkommens zu Beginn des Jahrtausends bildeten und ab da zur Institutionalisierung des Assetklasse führten. Der US-Markt ist reifer, zumal der ursprüngliche Impuls, nämlich der Ausbau des Interstate-Fernstraßennetzes, auf die 1950er Jahre zurückdatiert. In Europa variiert der Flächenbestand pro Kopf je nach Bedeutung der Lieferkette (europaweiter oder nationaler Schwerpunkt) und Marktreife. Das Angebot ist vor allem in MOE und südeuropäischen Ländern vergleichsweise knapp. Es ist damit zu rechnen, dass sich die allmähliche Etablierung des Segments fortsetzen wird, ohne allerdings mit dem US-Niveau gleichzuziehen, denn die Unterschiede in Bezug auf Geographie und Vermögen sind schlicht zu groß.
Die zunehmende Knappheit an Entwicklungsflächen betrifft ganz Europa, insbesondere aber Standorte nahe Verbrauchszentren. Selbst wenn einem Entwickler der Grundstückserwerb gelungen ist, sind die Antragsverfahren langwierig und komplex. Nach Angaben der Weltbank beträgt die Zeit bis zur Ausstellung einer Baugenehmigung in den zehn Ländern, in denen GARBE präsent ist, im Schnitt mehr als 170 Tage . Dagegen ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit in den USA nicht mal halb so lang (81 Tage). Nicht nur aufgrund des Flächenmangels sondern auch durch die NIMBY-Debatten („not in my backyard“) sind die Auflagen in den westeuropäischen Märkten verschärft worden.
Kommen Neuentwicklungen zustande, handelt es sich in Europa oft um Auftragsentwicklungen („built-to-suit“, BTS), anders als in den USA. Im Jahre 2023 galten 84 % aller Fertigstellungen in den USA als spekulativ, wohingegen der spekulative Anteil am gesamten Bauvolumen in Europa sich je nach Logistikmarkt zwischen 64 % (Italien) und knapp 40 % (Benelux und Deutschland) belief. Der niedrigere Anteil erklärt sich durch mehrere Faktoren, darunter Prinzip (Risikominimierung), Markttransparenz, langwierige Entwicklungshorizonte und strenge Marktregulierungen. Generell verringert ein geringerer Anteil an spekulativen Flächen das Risiko, dass es auf dem betreffenden Markt rasch zu einem Überangebot kommen könnte.
Angebotsbeschränkungen und strukturelle Nachfragetreiber haben in den vergangenen zehn Jahren zu einer Angleichung europäischer Leerstandsquoten an das US-Niveau geführt. Im Jahr 2023 erhöhte sich der Leerstand auf dem gesamteuropäischen Markt um ca. 100 BP, ohne aber die 4 %-Marke zu überschreiten. Auch die USA meldeten einen Anstieg der Leerstandsquote um 210 BP auf 5,2 %. Verursacht wurde der höhere Marktleerstand durch zunehmende Entwicklungstätigkeit und die Eintrübung der Stimmung auf Nutzerseite. In Europa wird mit einem geringfügigen Leerstandsanstieg in der ersten Jahreshälfte 2024 gerechnet, der aufgrund der niedrigeren Entwicklungsvolumen und des BTS-Schwerpunkts aber maßvoller ausfallen dürfte als in den USA. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird in beiden Regionen aufgrund der nunmehr reduzierten Entwicklungs-Pipeline ein Rückgang der Leerstände erwartet.
Anmerkung: Die EU-Statistik basiert auf den nationalen Leerstandsquoten von 9 Ländern (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Spanien und Italien).
Das Mietwachstum in Europa war zwar beachtlich in den letzten Jahren, aber es setzte in einer späteren Zyklusphase ein und fiel schwächer aus als die rasanten Zuwächse in den USA, die zwei Jahre lang in Folge im zweistelligen Bereich lagen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Europa und den USA besteht darin, dass inflationsbereinigte Mieten (reale Mietpreise) in vielen Märkten noch unter dem Niveau von 2006 liegen. Während der europäische Durchschnitt etwa -10 % beträgt, liegt er in den USA bei +45 %. Aus Investorensicht legt dies nahe, dass noch erhebliches Wachstumspotenzial bis zu einer Überteuerung der Märkte besteht. Aus Sicht der Nutzer wiederum bedeutet es, dass Immobilienkosten keinen erhöhten Anteil der Lieferkettenkosten ausmachen (Fixkosten inkl. Mieten: 3-6 % ).

Anfangsrenditen in Europa und den USA weisen einen mehr oder weniger vergleichbaren Trend auf, nämlich starke Kompression in den Jahren 2010 bis 2022, gefolgt von Expansion und Stabilisierung in den vergangenen zwei Jahren. Auf längere Sicht hat sich der Renditeabstand zwischen den beiden Regionen auf nahezu Null verringert, was den steigenden Institutionalisierungsgrad in Europa widerspiegelt.
Bei näherer Betrachtung diverser Marktparameter wird deutlich, dass die jeweiligen Strukturen der Logistikmärkte in den beiden Regionen Unterschiede aufweisen. Europa zeichnet sich durch ESG-Priorisierung und schärfere Regulierungen aus, während der US-Markt transparenter und etablierter ist, wobei zahlreiche KPI-Werte aber größerer Volatilität unterliegen.
Im Vergleich zu den USA war Europa von jeher weniger volatil, vor allem was Mieten, Kapitalwerte und Renditen betrifft . Es handelt sich um eine typische Eigenart des europäischen Marktes, insbesondere der kontinentaleuropäischen Märkte. Die relative Marktstabilität zählt für internationale Investoren zu den Anreizen, in den europäischen Markt für Logistikimmobilien zu investieren.
In den USA spielt ESG zwar ebenfalls eine bedeutende Rolle, doch allgemein gilt Europa hier als fortschrittlicher sowohl bei Investoren als auch bei Nutzern.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Logistikobjekte und -standorttypen der beiden Regionen einigermaßen vergleichbar sind. Ein Blick unter die Oberfläche verrät aber ein ganzes Spektrum an Unterschieden, aus denen sich sowohl Chancen als auch Herausforderungen ergeben. So bietet der europäische Markt ganz bestimmte, attraktive Investmentparameter, die langfristigem Wachstum zuträglich sind.
Aus Nachfragesicht umfassen diese Treiber unterversorgte Märkte, das Wachstum des Online-Handels auf Vor-Corona-Niveau und die zunehmende Umsetzung von Nearshoring-Ansätzen in Kontinentaleuropa. Auf der Angebotsseite wird die Gefahr eines Überangebots abgefedert durch immer höhere Hürden für Neubauentwicklungen und behördliche Auflagen. Diese Dynamik bei Angebot und Nachfrage sorgt für langfristiges Mietwachstum und anhaltendes Interesse auf Seiten der Kapitalgeber. Dagegen überzeugt der US-Markt mit einem höheren Reifegrad und im vergangenen Jahrzehnt mit starken Mietzuwächsen.
Logistikimmobilien haben im Laufe der Zeit aufgrund verschiedener neuer Nachfrageimpulse einen beeindruckenden Wandel erlebt, darunter der Siegeszug des E-Commerce, seiner entscheidenden Rolle während der COVID-19-Pandemie und den Auswirkungen der jüngsten Lieferkettenunterbrechungen. Gewisse Anzeichen deuten aber bereits neue Nachfrageimpulse an. Ihre möglichen Auswirkungen gilt es unbedingt unter die Lupe zu nehmen.
Dieser Wandel betrifft nicht nur die Vermietungsvolumen sondern auch expandierende Bereiche und neue Marktakteure. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit potenziellen neuen Nachfrageimpulsen für den europäischen Logistik-Sektor, die sich in einer Phase verschärfter geopolitischer Spannungen, fortlaufender technologischer Innovationen und in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld präsentieren.
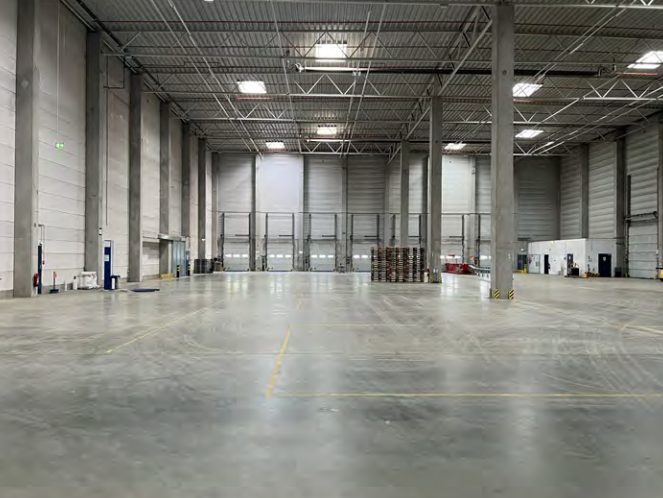
Nach mehreren Rekordjahren mit beispiellosem Nachfragevolumen hat sich das Vermietungsgeschehen normalisiert. Paneuropäische Vermietungstrends im ersten Quartal 2024 zeigen, dass der Flächenumsatz sich mittlerweile wieder dem Vor-Corona-Wert annähert, der in vielen Märkten immer noch als resilient bezeichnet werden kann. Mit einer Fortsetzung des Trends ist insofern zu rechnen, als fast 60 % der Nutzer beabsichtigen, innerhalb der nächsten drei Jahre zu expandieren.
Einer der Hauptgründe für dieses Maß an Resilienz ist die Bedeutung struktureller Nachfragefaktoren. Wie im Artikel „Why Invest in Europe“ erläutert, hat sich der Bestand an belegten Flächen im Zeitraum 2013-2023 fast verdoppelt, während sich das Wirtschaftswachstum in den neun untersuchten Ländern auf ~14 % belief. Dies ist beachtlich, denn es belegt, dass der europäische Markt auch zuzeiten verschärfter geopolitischer Spannungen und schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen funktioniert. Zahlreiche Stimmungsindikatoren in Deutschland liegen nach wie vor im negativen Bereich, haben sich aber im Lauf der letzten Monate leicht verbessert, wie der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts zeigt. Selbst der Automobil-Teilindex hat sich in den letzten zwölf Monaten von seinem Tiefstand erholt.
Genau wie Volkswirtschaften, Konsumgewohnheiten und Technologien entwickeln sich auch Bedarfsquellen fortlaufend weiter. GARBE Research hat drei verschiedene Nachfragekategorien von steigender Bedeutung ermittelt.
Da wäre zum einen die Expansion und Diversifizierung im Online-Handel. Nach einer Pause in den Jahren 2022 und 2023 ist in den kommenden fünf Jahren im E-Commerce zunehmende Marktdurchdringung und Umsatzwachstum in ganz Europa zu erwarten. Die Prognosen lauten zwar auf Zuwächse in allen E-Commerce-Segmenten, allerdings unter Verschiebung der Marktanteile. Die Bereiche mit den voraussichtlich größten Zugewinnen beim Marktanteil sind die Aufsteiger Lebensmittel, Möbel und Mode. Die Marktanteile von Elektronik und Medien, die zu den ersten Segmenten mit Online-Vertrieb zählen, dürften dagegen in eine Plateauphase eintreten.
Es ist damit zu rechnen, dass der Online-Handel mit Lebensmitteln und Möbeln zu einem Anstieg der Nachfrage nach Logistikimmobilien näher am Endkunden führen wird, da die jeweiligen Produkte zeitkritisch (Frischware) bzw. sperrig (Möbel) sind. Die zunehmende Nachfrage nach Logistik-Objekten im Modesektor dürfte von sogenannten Fast-Fashion-Anbietern ausgehen, die derzeit eine rasante Marktdynamik aufweisen. Internationale Einzelhändler wie SHEIN und Temu expandieren kräftig und suchen zunehmend nach Logistikflächen in Abkehr von der bislang verfolgten Luftfrachtstrategie. Dies ist insofern plausibel, als diese Händler mit ihrem enormen Transportvolumen seit einigen Jahren mit zu den weltweit größten Nutzern von Frachtflügen zählen. So betreibt SHEIN bereits ein Verteilzentrum im polnischen Wrocław und plant eine weiteres in Frankfurt am Main.
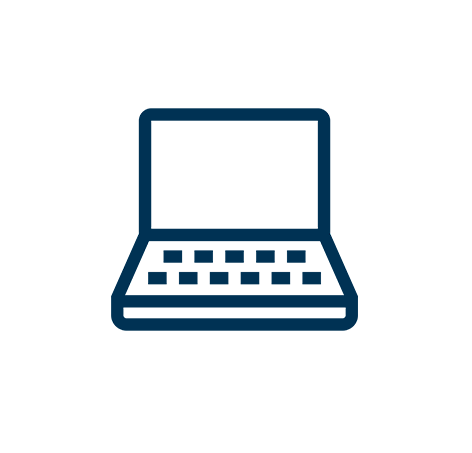
Gleichzeitig aber scheint der Quick Commerce, also die Eilzustellung von Onlinebestellungen, an Schwung verloren zu haben, da vielen Anbietern der Wettbewerb zu intensiv und die Rentierlichkeit zu ungewiss geworden ist. Erst kürzlich gaben Getir und Gorillas bekannt, sich aus dem deutschen Markt zurückziehen zu wollen, was dementsprechend Flink hierzulande zum Marktführer machen würde.
Das Jahr 2023 stellte einen neuen Rekord auf in Bezug auf das Gesamtvolumen an ausländischen Direktinvestitionen (ADI), Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe und projektspezifische Investitionen in Europa. Dabei sorgen nicht nur die eigentlichen ADI-Investments für neue Nachfrage nach Logistikimmobilien sondern auch verbundene Unternehmen und Zulieferer. Zwei Drittel aller Hersteller erwarten, dass ihre Zulieferer sich in der Nähe ihrer Standorte ansiedeln, was für die lokale Marktnachfrage einen selbstverstärkenden Schwungradeffekt auslöst. Neben der Standortnähe der Zulieferer ist mit einer zunehmenden Diversifizierung der Zulieferer zu rechnen, da 60 % aller Industrieunternehmen diese Strategie verfolgen. Wie sich anhand der Re-/Nearshoring-Karte von GARBE ergibt, hat die CEE-Region das größte Potenzial, den Ansiedlungsbedarf im Zuge des Nearshoring-Trends zu binden.
In ihren Bestrebungen nach resilienteren und agileren Lieferketten tendieren die bereits in Europa aktiven Nutzer zu einer Dezentralisierungsstrategie, u. a. durch den Aufbau von dezentralen Knotenpunkten. Daher ist in ganz Europa mit einer Zunahme kleinerer Objekte (<20.000 m²) zu rechnen. Wie der Beitrag „Mobilität im Blick: Die europäische Automobilbranche im Wandel“ darlegt, müssen auch neue Elektrofahrzeugbauer erst noch ein Lieferkettennetz aufbauen, das von der Fertigung bis hin zu Service und Ersatzteilen alles abdeckt. Da Logistikimmobilien zur Bedienung von Kundendienstansprüchen unverzichtbar sind, ergibt sich auch hier ein Mehrbedarf an Flächen.
Es ist davon auszugehen, dass auch neue Technologien längerfristig für einen allmählichen Anstieg der Nachfrage sorgen werden, und zwar vor allem seitens der Zulieferer der entsprechenden High-Tech-Fertigungsstätten. Produktionsstätten sind oft mit modernster Technik ausgestattet, und ihre spezifischen Gebäudemerkmale schlagen sich in einer hohen Selbstnutzerquote nieder.
Die dieser dritten Kategorie zuzurechnende Expansion zeigt sich bereits bei Produktionsstätten für Batterien (siehe Abbildung 4), für Elektrofahrzeuge und für Halbleiter in Europa, so etwa das Intel-Werk in Magdeburg. Die Wachstumsdynamik dieser Kategorie steht im Kontext verschärfter geopolitischer Spannungen und dem Umbau der europäischen Wirtschaft zwecks Minderung der Abhängigkeit von einigen wenigen globalen Zulieferern. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass Europa nach wie vor auf die Beschaffung von Rohstoffen aus aller Welt angewiesen ist.
Die drei beschriebenen Kategorien dürften für einen stetigen Anstieg der Nachfrage auf dem Logistikimmobilienmarkt in ganz Europa sorgen.
Der allmähliche Wandel der Nachfragetreiber hat im Lauf der letzten Jahrzehnte für drastische Veränderungen im Logistik-Sektor gesorgt. Mit einem Abflauen dieses Trends ist auf absehbare Zeit nicht zu rechnen, zumal sich die nächsten Nachfrageimpulse schon andeuten. Sie werden den Sektor nicht revolutionieren, sondern tragen zu seiner fortlaufenden Evolution bei.
Die Grundnachfrage zur Deckung der allgemeinen Versorgung und der Bedürfnisse des modernen Alltags besteht unverändert fort, mit der Entstehung neuer Nachfragedimensionen ist jedoch zu rechnen. Die neuen Nachfragetrends werden von übergreifenden Entwicklungen bestimmt, darunter veränderte Konsumgewohnheiten, verstärkte Schwerpunktsetzung auf Resilienz, Agilität und technologische Innovationen.
Mit ihren Anstrengungen, sowohl Innovationsdruck als auch konjunkturelle Herausforderungen zu bewältigen, ist die Automobilindustrie fast täglich in den Schlagzeilen.
Gleichzeitig zählte der Bereich Fertigung, auch und gerade in der Automobilbranche, im vergangenen Jahr zu den wesentlichen Treibern der Nachfrage nach Industrie- und Logistikflächen in Deutschland. Die Bedeutung des Kraftfahrzeugbaus für die Gesamtwirtschaft und den Immobiliensektor macht es umso wichtiger, die künftige Ausrichtung der Branche zu definieren, ohne dabei das Primat der Mobilität aus dem Blick zu verlieren.
Die Automobilindustrie zählt zu den wesentlichen Treibern der europäischen Wirtschaft und der Nachfrage nach Logistikimmobilien. Allerdings durchläuft die Branche aktuell einen Wandel, der von Innovation, anziehendem globalem Wettbewerb und Konjunkturschwäche bestimmt ist. Daher gilt es, die neuesten Entwicklungen im Auge zu behalten, um Risiken und Chancen frühzeitig zu erkennen.
Wichtigste Erkenntnisse:
Die Autoindustrie ist eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft
Statistische Kerndaten in Schaubild 1 veranschaulichen die Bedeutung der Automobilindustrie für Europa. Außerdem geht von der Autoindustrie ein bedeutender Multiplikatoreffekt für die Wirtschaft aus, der sowohl vorgelagerten Branchen wie der Stahl-, Chemie- und Textilproduktion zugutekommt als auch nachgelagerten Branchen wie dem IKT-Bereich, Kfz-Werkstätten und Mobilitätsdienstleistern.
| Säule der Wirtschaft: > 1 Billion € 2022 zum EU-BIP beigetragen ~7 % des EU-BIP |
Job-Generator: 13,8 Mio. Beschäftigte in der Autoindustrie 6,1 % aller Beschäftigten in der EU |
Made in Europe: ~165 Werke in Montage und Fertigung ~102 Mrd. € Handelsüberschuss der EU |
Innovationstreiber: ~60 Mrd. € Jahresausgaben für F&E ~30 % der F&E-Gesamtausgaben in der EU |
| Schaubild 1: Bedeutung der Autoindustrie für die europäische Wirtschaft |
Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Wie sich aus Schaubild 2 ergibt, trübte sich die Stimmung unter Autoherstellers nach dem letzten Höchststand Anfang 2022 rasch ein und ist derzeit auf dem niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise, ausgenommen der Zeit der Pandemie. Für die gedrückte Stimmung gibt es mehrere Ursachen, darunter die mageren Aussichten für die globale Konjunktur, die zunehmende Konkurrenz (im Bereich der E-Mobilität vor allem aus China), verstärkter Druck durch Schadstoffregelungen und relativ hohe Energiepreise. Immerhin lassen erste Anzeichen auf langfristigen Aufwind im deutschen Automobilsektor schließen. So deutet der jüngste Bericht des ifo-Institutes eine Verbesserung der aktuellen Geschäftslage an und meldet eine Stimmungsaufhellung im April 2024.
Anmerkung: saisonbereinigt, NACE-Level: Herstellung von Kraftwagen, Anhängern und Sattelaufliegern.
Vielschichtige Nachfrage durch Autoindustrie
Zunächst ist festzustellen, dass die derzeitigen konjunkturellen Verwerfungen die Erweiterungspläne für Logistikimmobilien einschränken, sofern der Schwerpunkt ausschließlich auf Kosteneffizienz liegt. Allerdings ist die Nachfrage der Automobilindustrie vielschichtiger Natur. Denn ihr Bedarf an Logistikflächen wird nicht nur von konjunkturbedingter sondern auch konjunkturunabhängiger Nachfrage bestimmt, etwa durch Reifenhersteller und Ersatzteillieferanten. Ferner kommen auch neue Treiber zum Tragen, wie z. B. die führende Rolle der Branche bei Innovationen. So wurden in den letzten Jahren zahlreiche F&E-Einrichtungen in ganz Europa ins Leben gerufen, die ihren eigenen Logistikflächenbedarf generieren. Insgesamt verschiebt sich der Schwerpunkt der Logistikflächennachfrage von traditionellen Treibern der Automobilbranche hin zu neuen Trends wie z. B. der E-Mobilität.
Die Konkurrenzfähigkeit von E-Fahrzeugen gegenüber Verbrennern kann durch Innovationen weiter erhöht werden.
Der Siegeszug der Elektrofahrzeuge als Wendepunkt
Der Übergang zur E-Mobilität wirkt sich auf alle Aspekte der Branche aus, also auch auf die zugehörigen Lieferketten und Logistikimmobilien. Laut IEA wird sich der Anteil an Elektroautoverkäufen von 21 % im Jahre 2023 auf voraussichtlich 60 % erhöhen und der Gesamtabsatz an batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen dürfte sich bis 2030 mehr als verdreifachen auf 6,8 Millionen. Die Prognosen anderer Analysehäuser wie UBS, HSBC und Jefferies für die Absatzzahlen bis 2030 liegen sogar noch höher. Somit bleibt der Ausblick ungeachtet des jüngsten Umsatzeinbruchs rosig. Der Übergang zum nötigen Volumen setzt im nächsten Schritt das Entstehen eines Massenmarktes mit attraktiver Preisgestaltung voraus. Innovative Fertigungsverfahren, wie die von Tesla eingeführten Giga-Casting- oder Unboxing-Ansätze, könnten für mehr Akzeptanz von E-Fahrzeugen bei Verbrauchern sorgen, da sie die Produktionskosten senken und somit die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Verbrennern erhöhen.
Anmerkung: Prognosen sind nur für die Jahre 2025 und 2030 verfügbar. Europa umfasst die EU der 27, Norwegen, Island, die Schweiz und Großbritannien.
Hinter dem Umsatzwachstum bei E-Autos stehen nicht nur etablierte sondern auch aufsteigende Automarken wie der Hersteller BYD, der seinen Marktanteil von 1,1 % im Jahr 2023 bis 2025 auf 5 % zu steigern beabsichtigt. Die Aktivitäten von BYD sind ein gutes Beispiel für die allgemeinen Trends bei Lieferketten und Logistikimmobilien. Um Unterbrechungen der Lieferkette und Gefahren im Roten Meer zu umgehen, beschaffte sich das Unternehmen jüngst einen Frachter mit einer Kapazität von 7.000 Fahrzeugen, der Europa über Bremen beliefern soll. Die für 2026 geplante Produktionsstätte in Ungarn wiederum kann als Beispiel für den Nearshoring-Trend nach dem Motto „in Europa, für Europa“ gelten.
Auch Zulieferer und ihre Lieferketten befinden sich im Wandel aufgrund der deutlich verringerten Zahl von Fahrzeugteilen (als Faustformel ist von einem Drittel im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren auszugehen) bei gleichzeitig steigendem Bedarf an Halbleitern und Batterien. Im Zusammenhang mit diesem Bedarf steht auch die absehbare Ausweitung der Batterieproduktion in Europa, dargestellt in Schaubild 4, zu deren Hauptabnehmern die Automobilindustrie zählen wird.
„Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten“
Die Automobilindustrie befindet sich ganz offensichtlich in einer Umbruchphase mit grundlegenden Herausforderungen. Es trifft die europäische Automobilbranche jedoch nicht zum ersten Mal. So sorgte etwa der Aufstieg japanischer Marken in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren für starke Konkurrenz, doch die europäischen Marken passten sich im Lauf der Zeit erfolgreich an. Nach Ansicht von Analysehäusern wie z. B. der Commerzbank erfolgt die Anpassung europäischer Autobauer durch die Konzentration auf das Kerngeschäft und auf Effizienz. Zwar hat Europa spät reagiert, doch die angekündigten E-Modelle dürften sich mit der globalen Konkurrenz messen lassen, und die Investitionen vieler führender europäischer Hersteller werden erst im kommenden Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Derweil beobachten Analysehäuser die mittelständischen Zulieferer, denen die Anpassung u. U. schwerer fällt, was wiederum eine Konsolidierungsphase in der Branche einleiten könnte.
Fazit: Implikationen für Logistikimmobilien im Überblick
Die Automobilindustrie spielt eine bedeutende Rolle für Logistikimmobilien, wobei die vielschichtige Nachfrage in diesem Sektor von der Endmontage über innovative Technologien, z. B. für Elektrofahrzeuge, bis hin zu Ersatzteilen alles umfasst. Etablierte Nutzerstrategien, um den steigenden Kostendruck zu bewältigen, legen zunehmend den Schwerpunkt auf Standort (z. B. Nähe zu Kunden und Zulieferern) und Gebäudeeffizienz (z. B. Energiekosten). Im Zuge des Branchenumbruchs rechnen wir damit, dass traditionelle Nachfragetreiber an Bedeutung verlieren und neue Trends an Bedeutung gewinnen werden, so dass der Flächenbedarf unterm Strich mehr oder weniger stabil bleiben wird und etablierte Standorte durch neue Hotspots ergänzt werden.
Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen legen Nutzer vor allem Wert auf stabile Lieferketten, was eine zunehmende Produktionsverlagerung im Sinne von „in Europa, für Europa“ nach sich zieht. Dies wiederum manifestiert sich im steigenden Bedarf an hochmodernen F&E-Einrichtungen sowie dem Aufbau von Fertigungsstätten für Elektrofahrzeuge und Batterien. Als Nebeneffekt generieren die neuen Standorte eine entsprechende Nachfrage nach Logistikflächen seitens der Zulieferer.
Quellen:
(1) Quelle: McKinsey & Company, ACEA. Anmerkung: Datenstand Sommer 2023
(2) Quelle: Europäische Kommission Anmerkung: saisonbereinigt NACE-Level: Herstellung von Kraftwagen, Anhängern und Sattelaufliegern
(3) Quelle: IEA. Anmerkung: Prognosen sind nur für die Jahre 2025 und 2030 verfügbar. Europa umfasst die EU der 27, Norwegen, Island, die Schweiz und Großbritannien.
Im Interview mit Richard Betts von Real Asset Insights verrät Christopher Garbe, geschäftsführender Gesellschafter von GARBE Industrial Real Estate, spannende Einblicke, wie das Unternehmen mit der herausfordernden Marktsituation umgeht. Immer im Fokus: die nationalen und internationalen Investoren sowie Private Equitiy, bei denen die Assetklasse Logistikimmobilien zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Erfahren Sie, welches Potential er in der digitalen Infrastruktur sieht und wie das Unternehmen durch Energieeffizients- und ESG-Maßnahmen wie beispielsweise die Installation von PV-Anlagen und die Nutzung von Wärmepumpen Immobilien in energieproduzierende Assets verwandelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Erfahren Sie mehr aus der Welt von GARBE und erhalten Sie spannende Einblicke in unsere vielfältigen Projekte und Entwicklungen. Ein besonderes Highlight ist unser Bauprojekt im Hafen Straubing, wo die größte Logistikimmobilie Europas in reiner Holzbauweise entsteht. Auch das einzigartige 19-stöckige Holzhaus Roots von unserer Schwestergesellschaft der GARBE Immobilien Projekte zeigt eindrucksvoll, wie ökologisches Bewusstsein und moderne Architektur Hand in Hand gehen können.
Auf dem ca. 47.000 m² großem Grundstück entsteht die in Europa größte Logistikimmobilie in reiner Holzbauweise entstehen und somit ein Leuchtturmprojekt. Nach
Das einzigartige 19-stöckige Holzhaus mit einer Höhe von ca. 65 Metern wird zukünftig Teil des Entreés für das Elbbrückenquartier in der Hamburger HafenCity sein.
Die GARBE Infrastructure kümmert sich um die Schaffung nachhaltiger Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und erneuerbare Energien.
Die NDC-GARBE ist ein Rechenzentrumsentwickler mit der Mission, die Digitalisierung zu dekarbonisieren.
Die MIPIM 2024 kann als Gradmesser für den Zustand der europäischen Immobilienwirtschaft verstanden werden. Nach wie vor ist diese im Griff der inflationsinduzierten Zinspreisrallye – auch wenn sich die makroökonomischen Rahmendaten verbessern.
Bevor die „Blicke nach vorne“ und die „zaghaften, positiven Anzeichen“ für den Rest von 2024 in der Branche diskutiert werden, steht erst einmal das österliche Durchatmen in der Immobilienbranche an.

Die Eierindustrie läuft zu Ostern auf Hochtouren. Aber wie haben sich hier die makroökonomischen Trends der letzten zwei bis drei Jahren niedergeschlagen?
In unserer GARBE PEIRAMID EGGSTRA haben wir die europäischen Märkte beleuchtet. Ergebnis unserer Recherche ist eine Übersicht, die den aktuellen Marktpreis, die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate sowie den harmonisierten Verbraucherpreis-Index der einzelnen Länder abbildet.
Der Jahresverlauf in der „Egg-Flations-Kurve“ zeigt eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei der allgemeinen Inflation. Zwar ist die Eierproduktion nicht so energieintensiv wie die Zement-, Glas- oder Stahlindustrie, aber die Teuerung steigt sogar noch deutlicher von einer Rate um 2,7 % im Jahr 2021 auf stolze 18,5 % im Jahr 2022 an. Während der Verbraucherpreisindex im Jahresverlauf von 2023 bereits spürbar nachließ, ging die Eier-Inflation nur marginal auf 15,6 % zurück.
Denn nicht alle Aspekte der Teuerung lassen sich bekämpfen – mit einem höheren Zinssatz schon gar nicht. Schaut man sich die Preise für Eier in Europa an, so gibt es eine hohe Spreizung bei den Erzeugerpreisen. Von den 20 in der „PEIramid“ untersuchten Ländern liegen acht Staaten oberhalb des Schnitts von 1,35 Euro pro 10er-Pack. Absoluter Spitzenreiter mit 1,60 Euro ist Österreich. Auch Deutschland gehört zu den teureren Ländern (1,50 Euro). Auch Schweden, Frankreich, Italien und Polen gehören zu dieser Gruppe. Erstaunlicherweise auch Estland. Warum erstaunlich? Da Litauen mit nur 0,99 Cent am komplett anderen Spektrum der Rangliste liegt, obwohl beide im Baltikum liegen und ähnliche Strukturen aufweisen.
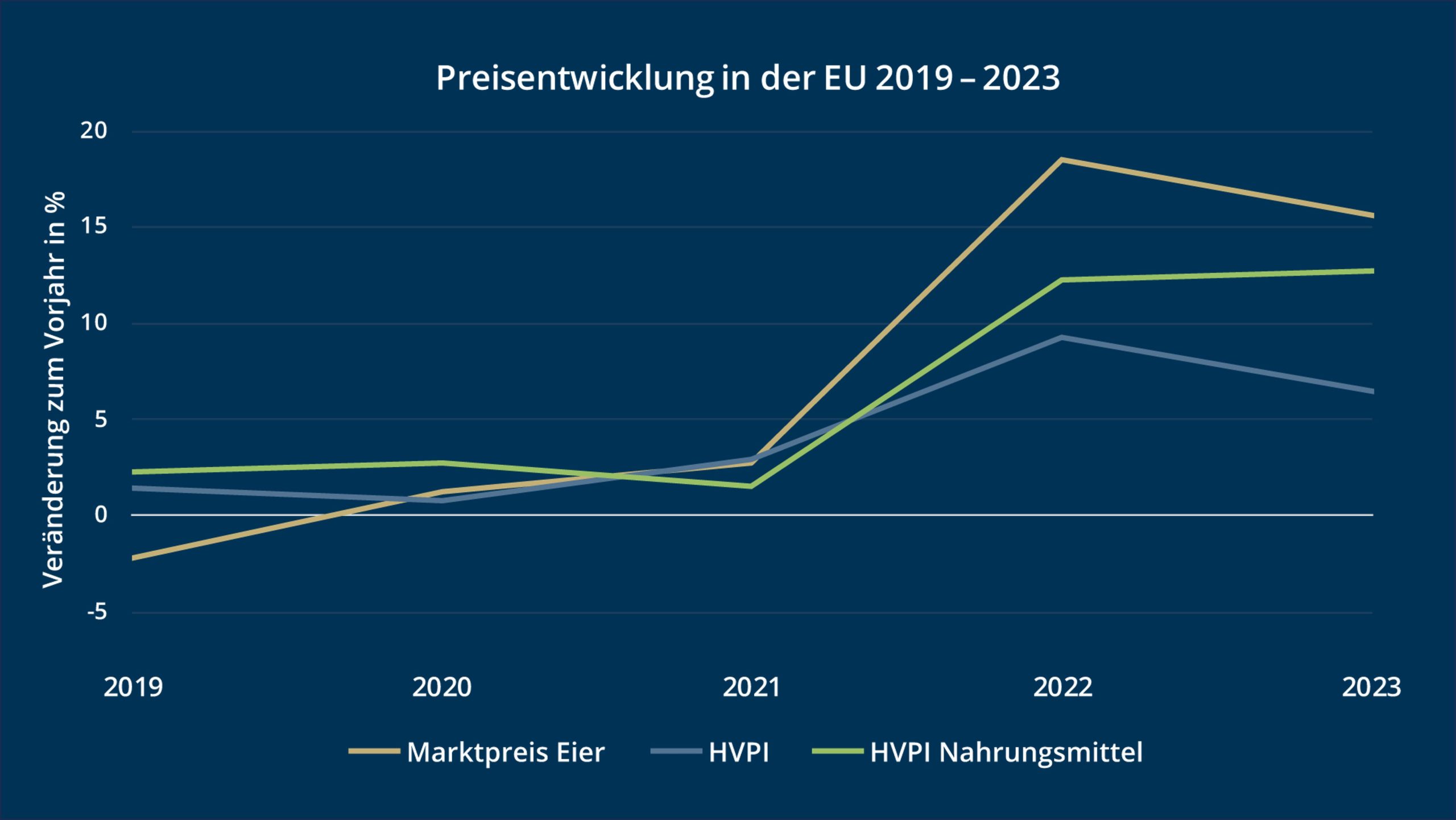
Die höchste Teuerung weist Deutschland auf mit einem CAGR von über 16 % im Betrachtungszeitraum der letzten fünf Jahre. Die Inflation liegt deutlich oberhalb der durchschnittlichen Teuerung von rund 12 % in der EU. Auch Spanien und Frankreich gehören zu den Ländern mit der höchsten Preissteigerung.
Die Eierindustrie leidet unter den gleichen makroökonomischen Rahmenbedingungen wie die Immobilienwirtschaft und spätestens Mitte 2022 sind Auswirkungen auch für Konsumenten und Weiterverarbeiter spürbar. Gründe: Weltweite Vogelgrippeausbrüche – massiv in Europa und den USA. Explosion der Futtermittelpreise, gestiegene Energiepreise, gestiegene Löhne sowie Kosten für Eierpappen. In Deutschland hat sich das Verbot des Kükentötens ebenfalls niedergeschlagen.
Während die Immobilienwirtschaft mit der Aussicht auf Besserung beschäftigt ist, bleibt es in der Eierindustrie weiter schwierig. Ab 2027 wird in der EU vermutlich die Käfighaltung verboten und umfassende Investitionen werden notwendig.
Die Eierpreise werden daher voraussichtlich nicht so schnell und stark sinken und die Eierinflation erhöht bleiben. Aber auch in den nächsten Jahren wird es Ostern geben und die Ostertage begleiten. Der Osterhase wird auch weiterhin viel zu tun haben.
In diesem Sinne die „Hasenohren steif halten“! Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern und viel Freude mit unserer PEIRAMID. Falls Sie sich neben der Eierindustrie auch für die Entwicklung der europäischen Logistikimmobilienmärkte interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere PYRAMID Map.

Managing Director UK der GARBE Industrial Real Estate UK Ltd und zuständig für die Unternehmensexpansion in Großbritannien.
Mit seiner hohen Zahl an Marktteilnehmern gilt der britische Logistikimmobilienmarkt als ausgesprochen wettbewerbsintensiv. Warum engagiert sich GARBE trotzdem so stark auf diesem Markt?
Der britische Logistikmarkt ist nach wie vor äußerst attraktiv sowohl für Investoren als auch für Entwickler weltweit, und zwar ungeachtet der aktuellen Marktkonjunktur und aller geopolitischen Verwerfungen. Der Markt weist eine ganze Reihe von kurz- und langfristigen Chancen für Entwickler und Investoren auf, die GARBE auf jeden Fall zu nutzen beabsichtigt.
Was den Markt von je her attraktiv gemacht hat, sind seine Transparenz sowie seine politisch und finanziell stabilen Rahmenbedingungen. Dabei ist es wichtig, in die Tiefe zu gehen und die Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die das heutige Marktgeschehen bestimmen und die GARBE für die kurz- und langfristigen Markttreiber hält.
Mittlerweile hat der Markt die Talsohle durchschritten und befindet sich aktuell in einer bemerkenswerten Phase der Bodenbildung. Verglichen mit dem übrigen Europa und anderen Regionen der Welt erfolgte die Preiskorrektur in Großbritannien rascher und deutlicher. Die Preisfindung auf dem britischen Markt hat also gerade ihren Tiefpunkt erreicht. Was den Ausblick betrifft, so rechnen wir damit, dass sich in den kommenden 12 bis 18 Monaten attraktive Investmentgelegenheiten sowohl bei Entwicklungsprojekten als auch bei Bestandsinvestitionen ergeben werden.
Gleichzeitig bietet die britische Finanzierungslandschaft interessante Optionen. Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern sind Banken hier weiterhin zur Finanzierung von Logistikentwicklungen bereit.
Selbst für spekulative Projektentwicklungen werden Kredite ausgereicht, sofern der Auftraggeber seriös ist und über eine solide Erfolgsbilanz verfügt. Tatsächlich bieten viele namhafte Kreditinstitute nach wie vor solche Finanzierungen an, so dass dies eine durchaus gangbare Option für Investments im Logistikbereich darstellt.
Der Markt zeichnet sich durch eine vielfältige Mieterbasis aus, die ein breites Spektrum an Unternehmen umfasst. Dazu gehören u. a. E-Commerce-Unternehmen, externe Logistikanbieter (3PL) und Großhändler. Die Vielfalt auf Nutzerseite stellt einen strategischen Vorteil dar, denn sie macht es relativ einfach, das Risiko der Abhängigkeit von nur einer Branche zu vermeiden. Aber auch die Nutzerlandschaft durchläuft einen Wandel, etwa indem Rechenzentren zu einem wichtigen Bestandteil der nationalen Infrastruktur werden und den Druck auf das begrenzte Flächenangebot weiter erhöhen.
Dementsprechend weist der Markt ein hohes Potenzial für Mietzuwächse auf. Einschlägige Prognosen sagen für den Fünfjahreszeitrum von 2023 bis 2027 ein durchschnittliches Wachstum von 5.0% voraus (Colliers). Dabei ist zu beachten, dass diese Einschätzung angesichts der laufenden Expansion des Online-Handels und des eingeschränkten Angebots durchaus übertroffen werden könnte.
Großbritannien bietet zudem ein günstiges Investmentumfeld mit seinem transparenten Immobilienrecht, den steuerlichen Anreizen in bestimmten Regionen und den gängigen Optionen bei der Immobilienfinanzierung.
Hinzu kommt, dass sich der britische Logistiksektor trotz konjunktureller Herausforderungen wie z. B. dem Brexit als widerstandsfähig erwiesen hat. Unternehmen passen sich an neue Realitäten im Handel und gestörte Lieferketten an und sorgen so für weiterhin hohen Bedarf an Logistikimmobilien.
Durch welche besonderen Merkmale unterscheidet sich der britische Logistikmarkt vom deutschen Heimatmarkt von GARBE?
Der britische und der deutsche Logistikmarkt sind jeder auf seine Art etabliert, und ein wirklich paneuropäischer Investor mit diversifiziertem Portfolio sollte Logistikobjekte in beiden Märkten im Bestand haben. Gleichzeitig aber handelt es sich um ganz unterschiedliche Märkte mit speziellen Nuancen, was es für GARBE wichtig macht, hier und anderswo in Europa direkt vor Ort zu sein.
Gewerbeimmobilien weltweit sind derzeit einem grundlegenden Wandel unterworfen, der sich mit drastischen Veränderungen in Bezug auf die Gebäudenutzung, das Zinsniveau und die Preisgestaltung verbindet. Das mag manche Investoren vor Probleme stellen, aber möglicherweise steuern wir auch auf einen der günstigsten Investitionszeitpunkte seit Jahrzehnten zu. In Großbritannien kommen eine Reihe von landestypischen Faktoren ins Spiel.
Der Logistikmarkt bewegt sich hier auf einen neuen Lieferstandard zu, da Verbraucher zunehmend nicht nur schnellere Lieferungen sondern auch Blitzzustellungen und personalisierte Lieferzeiten bei Online-Käufen erwarten. Infolgedessen wird im britischen Online-Handel mit einem Anstieg der Marktdurchdringung von heute 19% auf 35% im Jahr 2027 gerechnet. Im Vergleich dazu ist in Deutschland lediglich ein Anstieg von 13% auf 23% zu erwarten (Prognose: CBRE). Der entsprechende Logistikbedarf in Großbritannien würde die Erstellung von knapp 4,2 Mio. m² an Hallenfläche im gleichen Zeitraum erforderlich machen.
Britische Mietverträge enthalten eine so-genannte FRI-Klausel („full repairing and insuring“), welche die Verantwortung für Reparaturen und Wartung des gesamten Gebäudes auf den Mieter überträgt. Dies unterscheidet sich von der deutschen Regelung, nach welcher der Vermieter für die Reparatur und Wartung von Dach und Fach zuständig ist, und dies ist beim Vergleich von deutschen mit britischen Objekten unbedingt zu beachten, damit die ermittelten Nettoanfangsrendite die tatsächlichen Kosten von Immobilieneigentum abbilden.
Hinzu kommt, dass Mietpreise in Großbritannien aufgrund des Mangels an Bauland deutlich höher ausfallen. So steht dem Mietpreis von mittlerweile 30 €/m² in Park Royal/London eine Spitzenmiete von nur 10 €/m² in München gegenüber.
Die Stimmung in Bezug auf die langfristige Entwicklung der britischen Industrie ist weiterhin positiv, nur die Preisvorstellungen auf Verkäufer- bzw. Käuferseite klaffen immer weiter auseinander.
Was sind derzeit die wichtigsten Nachfragefaktoren auf dem britischen Markt?
Grundsätzlich sind zwei Nachfragetreiber zu nennen, wovon einer der E-Commerce ist. Wie schon erwähnt soll die Marktdurchdringung des Onlinehandels in Großbritannien bis 2027 auf 35% ansteigen im Vergleich zu einem europäischen Durchschnitt von 19%. Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird beim Onlinehandel mit einem Zuwachs um 29% gerechnet.
Beim anderen Nachfragetreiber handelt es sich um die strategische Lage. Großbritannien gilt als Gateway sowohl für den europäischen als auch den globalen Markt. Seine Nähe zu den großen europäischen Volkswirtschaften macht das Land zu einem attraktiven Standort für Logistik- und Distributionszentren. Die Attraktivität des Landes wird zusätzlich verstärkt durch sein effizientes Verkehrsnetz und den bequemen Zugang zu wichtigen Seehäfen wie z. B. London Gateway und Felixstowe.
In den letzten Quartalen verzeichneten die europäischen und britischen Investmentmärkte deutlich weniger Transaktionen als in den Vorjahren. Wann rechnen Sie mit einer Wiederbelebung des britischen Investmentmarktes?
Das ist natürlich die ganz große Frage. Sie lässt sich tatsächlich auch nicht beantworten, denn der Markt wird von so vielen Faktoren beeinflusst, darunter wirtschaftliche Rahmenbedingungen, geopolitische Ereignisse und globale Trends. In Großbritannien beliefen sich die industriellen Investmentvolumen im ersten Halbjahr 2023 auf 5,8 Mrd. €, was insofern für Unruhe sorgte, als es einen Rückgang von 56% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dabei wurde allerdings übersehen, dass der Betrag mehr oder weniger dem Fünfjahresdurchschnitt für erste Halbjahre der Vor-Corona-Zeit in Höhe von 4,9 Mrd. € entspricht.
Die Stimmung in Bezug auf die langfristige Entwicklung der britischen Industrie ist weiterhin positiv, nur die Preisvorstellungen auf Verkäufer- bzw. Käuferseite klaffen immer weiter auseinander.
Es steht jede Menge Kapital bereit, das darauf wartet, dass sich der Markt stabilisiert hat, und in den letzten sechs Monaten verzeichneten wir eine starke Nachfrage nach Value-Add-Objekten, deren Wertentwicklung sich durch aktives Asset-Management optimieren ließe. Opportunistische Käufer hoffen ganz offensichtlich auf Bestände, die in Schieflage geraten sind, doch bislang hat sich an der soliden Marktkapitalisierung nichts geändert. Trotzdem rechnen wir damit, dass sich im Lauf des Jahres 2024 interessante Gelegenheiten am Markt ergeben und zwar bei Kreditnehmern, deren Bestände sich nicht refinanzieren lassen und stattdessen zwangsversteigert werden.
Wir gehen davon aus, dass die Inflation in Großbritannien weiter sinken und der Basiszinssatz nicht weiter angehoben wird, und können uns für das kommende Jahr eine leichte Renditekompression vorstellen, die im ersten Halbjahr 2024 das Marktgeschehen beleben dürfte.
Welche Regionen betrachten Sie als die potenziellen Aufsteiger der britischen Logistiklandschaft? Inwiefern unterscheiden sie sich von klassischen Logistikregionen wie London oder Birmingham?
Der britische Markt ist geprägt von regionalen Unterschieden in Bezug auf die Ausgestaltung von Infrastruktur, Branchenclustern und Verkehrsnetzen. Für Investoren und Entwickler ist es unabdingbar, die regionale Dynamik zu verstehen, denn die Struktur neu entstehender Zentren wird durch Nutzer bestimmt, indem sie ihre Netzwerkplanung optimieren, strategische Partnerschaften eingehen und konkrete Anforderungen der Wirtschaft bedienen.
Das „goldene Dreieck“ der britischen Logistik in den West Midlands nahe Birmingham ist dank seiner guten Anbindung an den Rest des Landes von jeher ein klassischer Schwerpunkt. Von hier aus sind 90% der britischen Bevölkerung binnen 4 Stunden Fahrzeit zu erreichen. Zwar wird die Nachfrage nach Flächen in London und Birmingham auch künftig hoch sein, doch aufgrund der veränderten Dynamik und der Suche nach günstigeren Lösungen seitens der Logistikbetreiber bilden sich neue Märkte heraus.
Zu den aufstrebenden Zentren im nördlichen England in und um Manchester gehört etwa Warrington als mittlerweile etablierter Standort und in jüngster Zeit auch Standorte in Yorkshire und an der Humber-Mündung.
Ein weiterer Aufsteiger ist Avonmouth (Bristol) im Südwesten Englands, wo im Lauf der letzten zehn Jahre viele großflächige Logistiklager entstanden, darunter die mit 82.000 m² größte spekulativ errichtete Lagerhalle überhaupt.
Ferner zu nennen sind Seehäfen, die dank der erhöhten Nachfrage durch 3PL-Unternehmen und der Verfügbarkeit von günstigem Strom in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen dürften. Auch Flächen in und um die Hafenstädte Felixstowe, Southampton, Liverpool und Hull erfreuen sich nach unseren Beobachtungen wachsender Beliebtheit.
Der Onlinehandel hat durch die COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ein enormes Wachstum in Deutschland erfahren. Nachdem in den Vorjahren das jährliche Wachstum zwischen 9 bis 12 % schwankte, lag es in den beiden Pandemie-Jahren bei 23 bzw. 19 %. Zum Vergleich: Im Einzelhandel lag die Umsatzsteigerung insgesamt bei 6,2 bzw. 1,6 %. Mit einem Umsatz von 86,7 Mrd. EUR wurde 2021 ein Rekordergebnis im E-Commerce erzielt. Im vergangenen Jahr setzte dann eine leichte Konsolidierung ein – der Umsatz ging erstmals zum Vorjahr leicht zurück (-2,5 %).
Im Jahr 2022 lag der Anteil des E-Commerce am Gesamtumsatz des Einzelhandels in Deutschland bei knapp 20 %, womit es sich um einen der etabliertesten Märkte in Europa handelt. Unter den großen EU-Staaten ist dies der zweithöchste Wert nach UK (26,5 %). In Spanien und Italien liegt der Anteil bei rund 10 %. Dieser Schwellenwert wurde in Deutschland bereits 2014 überschritten. In Deutschland soll der Anteil bis 2028 noch einmal um etwa 10 %-Punkte ansteigen.
Abbildung: Entwicklung Onlineumsatz (netto) in Deutschland 2000–2022
Das starke Wachstum der Onlinehändler äußerte sich auch durch einen signifikanten Anstieg der Logistikflächennachfrage durch diese Nutzergruppe während der COVID-19-Pandemie. Im zweiten Halbjahr 2022 ließ die Nachfrage dann deutlich nach, konnte aber durch klassische Handelsunternehmen kompensiert werden. Lag der Anteil des Onlinehandels am Flächenumsatz in den Pandemiejahren 2020 und 2021 bei 19 bzw. 20 %, waren es im Jahr 2022 nur noch 13 %.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres kamen Handel und Onlinehandel zusammen auf nur noch 19 %. Der Flächenumsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 70 %. Sind die aktuellen Umsatzzahlen also Anzeichen für eine Marktsättigung und wie wird sich der Onlinehandel insgesamt weiterentwickeln?
Die Konsolidierung des Onlinehandels setzt sich im laufenden Jahr fort. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen liegt um 13,7 % unter dem Vorjahreswert. Dies ist vorwiegend auf die konjunkturelle Entwicklung in Verbindung mit der Inflation zurückzuführen. Die Privathaushalte halten sich bei Konsumausgaben zurück, da sie durch die Inflation mit einer deutlich höheren Ausgabenbelastung konfrontiert sind. Dass vor allem konjunkturelle und weniger branchenstrukturelle Effekte Auswirkungen auf die aktuelle Umsatzentwicklung haben, zeigt die weiterhin hohe Bestellfrequenz bei Onlinehändlern.
Für das letzte Quartal sehen Branchenexperten aktuell keine Wachstumsimpulse für den Konsum. Würde der Rückgang für das Gesamtjahr ähnlich ausfallen wie in den ersten drei Quartalen, wäre in etwa das Niveau von 2020 erreicht – ein Jahr mit enormem Wachstum.
Die Entwicklung des Onlinehandels ist also aktuell vor allem aufgrund der Zurückhaltung beim Konsum gedämpft. Ein gewisser Anteil des Rückgangs dürfte aber auch auf die Rückverlagerung des Konsums in den stationären Handel nach der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein. Dafür spricht, dass der Einzelhandelsumsatz insgesamt in den ersten Quartalen lediglich um 4,6 % zum Vorjahr zurückgegangen ist. Welche Entwicklungsimpulse gibt es aber innerhalb der Branche und welche Trends sind zu beobachten?
In der Textilbranche vollzieht sich gerade die nächste Revolution. Nachdem der deutsche Onlinehandel in diesem Segment in den vergangenen Jahren vor allem durch die zwei großen europäischen Player H&M und Zara dominiert wurde, steigern nun die zwei chinesischen Konzerne Shein und Temu ihre Marktanteile in einem enormen Tempo. Ihr Vorteil gegenüber den etablierten Akteuren ist, dass sie keine stationären Flächen betreiben und basierend auf dem Modell „Consumer-to-Manufacturer“ (C2M) mithilfe künstlicher Intelligenz deutlich schneller auf Trends und Kundenwünsche reagieren können.
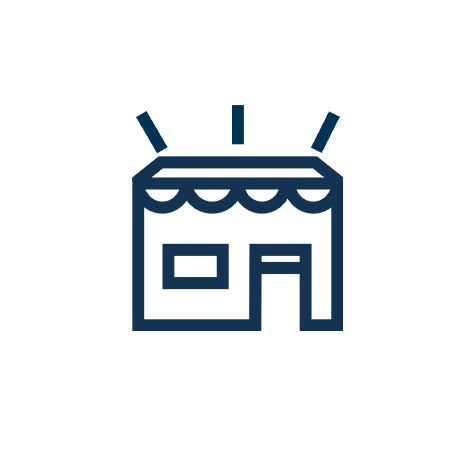
Das Geschäftsmodell wird als „Realtime-Fashion“ oder „On-Demand-Fashion“ bezeichnet. Die Kunden können so weltweit ohne Zwischenhändler direkt bei den Herstellern, die vorwiegend in China sitzen, bestellen. Das Preisniveau ist nochmals niedriger als bei den etablierten „Fast-Fashion“-Ketten.
Die Zahl der Paketsendungen nach Deutschland belaufen sich für das laufende Jahr nach Schätzungen bereits auf rund 30 Mio. für Shein und etwa das Doppelte für Temu. Zugute kommt den beiden Konzernen dabei die zollfreie Einfuhr von Einzelsendungen (150 Euro). Mit dem rasanten Wachstum investieren die Unternehmen in ihre Logistikkonzepte in Europa. In Polen wurden bereits Distributionszentren bezogen. Mit einem Netz an Warenlagern in Europa will man die Möglichkeit schaffen, Bestände innerhalb der EU zu bewegen. In diesem Zuge sollen auch EU-Vorschriften besser berücksichtigt werden. Ein Risiko der Expansion stellt die Zufriedenheit der Kunden dar, die im Hinblick auf die Produktqualität an europäische Standards gewöhnt sind.
Als weiterer potenzieller Nachfrager könnte TikTok in den kommenden Jahren auftreten. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance investiert aktuell stark in den Ausbau der integrierten E-Commerce-Lösung „TikTok Shop“. Damit haben Nutzer die Möglichkeit, Produkte, die sie in der App sehen, direkt zu bestellen. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen wird auch als „Social Commerce“ bezeichnet. In Teilen Asiens ist dieses Konzept bereits sehr erfolgreich. Global werden dem Marktsegment ein enormes Wachstum in den kommenden Jahren prognostiziert. In Europa ist das Thema noch sehr jung und wird bisher vor allem durch Shopify bedient. Mit Großbritannien als Pilotmarkt investiert Bytedance nun auch in Europa – andere Länder könnten folgen.
Ein starker Nachfrager der vergangenen Jahre im Bereich Onlinehandel war Amazon. Der US-Konzern hat sein Netz an Logistik-, Sortier- und Verteilzentren in Deutschland und Europa deutlich ausgebaut. GARBE Research hat im Rahmen einer Untersuchung etwa 225 aktive Amazon-Standorte in Europa identifiziert, darunter 115 in Deutschland. Danach folgen UK mit 57 Standorten sowie Italien, Frankreich, Polen und Spanien mit jeweils zehn bis zwölf Objekten. Allein im Jahr 2022 hat Amazon die Anzahl der Standorte in Deutschland um etwa ein Viertel erhöht.
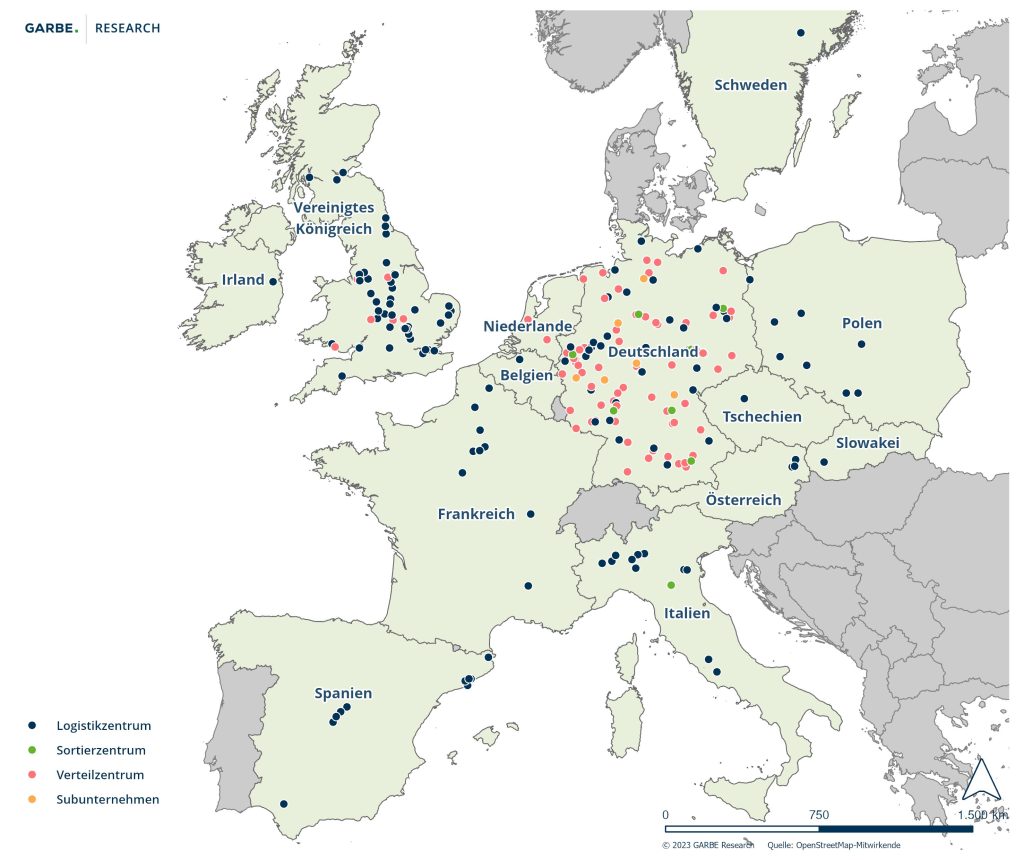
Abbildung: Amazon-Standorte in Europa
Der rückläufige Umsatz im Onlinehandel macht sich nun auch bei Amazon bemerkbar. Flächen an 13 Standorten sollen ganz oder anteilig temporär untervermietet werden, um Überkapazitäten der aktuellen Marktphase zu vermeiden. Untervermietungen bieten den Vorteil, dass bei zukünftigen Mehrbedarfen Flächen zeitnah zur Verfügung stehen. Kurzfristig ist also keine starke Nachfrage an zusätzlichen Flächen durch Amazon für den klassischen Onlinehandel zu erwarten.
Potenzielle Nachfrage ergibt sich vielmehr durch den im September vorgestellten neuen Service „Supply Chain by Amazon“, der Logistikdienstleistungen für Dritte anbieten soll. Das Geschäftsmodell umfasst die Belieferung von Lagern anderer Handelsunternehmen, die Anmietung von Lagerflächen an Amazon-Standorten und die Versorgung weiterer Verkaufskanäle mit Waren. Mit diesem Schritt würde man die eigenen Immobilien effizienter nutzen und dem Ziel, „größter Transporteur der Welt“ zu werden, näher kommen. Der US-Konzern würde so in direkte Konkurrenz mit Anbietern wie UPS und FedEx treten. Bei einer erfolgreichen Umsetzung des Services ist perspektivisch von weiteren Flächenbedarfen über die bestehenden Standorte hinaus auszugehen.

Die Lieferkonzepte, die gerade während der Pandemie ein enormes Wachstum verzeichnet haben, konsolidieren sich aktuell oder ziehen sich ganz aus dem deutschen Markt zurück. Das Konsumverhalten hat sich nicht dauerhaft verändert. Zudem wurde der Zugang zu Risikokapital durch die Zinswende deutlich erschwert.
Generell ist der Anteil von Lebensmitteln am Onlinehandel mit nicht einmal 2 % in Deutschland aktuell noch sehr gering. Dementsprechend schwer ist es für neue Anbieter, wenn sie keine Kooperation mit den etablierten Marktakteuren eingehen. So hat der niederländische Lieferdienst Picnic etwa mit EDEKA einen starken Partner. Ende 2023 werden knapp 60 Verteilzentren in Betrieb sein.
Bis 2030 soll der Anteil des Online-Lebensmittelhandels auf 8 % ansteigen (ca. 22 Mrd. EUR). Um dieses Feld nicht anderen zu überlassen, investieren die großen Player auf dem deutschen Markt in eigene Angebote oder eben mit strategischen Partnern. Neben Picnic (EDEKA) gibt es Flink (REWE) und REWE Digital. ALDI Nord und Süd betreiben mittlerweile einen gemeinsamen Onlineshop für sperrige Aktionsartikel. ALDI Süd testet darüber hinaus aktuell einen Lieferdienst im Raum Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen.
Es ist davon auszugehen, dass der Online-Lebensmittelhandel aufgrund der stark gefestigten Strukturen im Markt auch perspektivisch vor allem von den vier großen Platzhirschen dominiert wird. Akteure wie Amazon haben sich bereits aus dem Segment zurückgezogen, da der Aufbau eines eigenständigen neuen Logistiknetzes viel zu hohe Investitionen in einem bereits hart umkämpften Markt erfordern würde. Die zukünftige Flächennachfrage wird vor allem durch die Digitalisierung und Neuaufstellung der logistischen Prozesse sowie den Aufbau von (kleinen) Verteilzentren generiert.
Die aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen erschweren verlässliche Prognosen für die zukünftige Flächennachfrage durch den Onlinehandel. Fest steht, dass der durch die Pandemie getriebene Boom vorbei ist und viele Unternehmen ihre Wachstumsstrategien überarbeitet haben.
Gleichzeitig tun sich neue Akteure und Geschäftsmodelle auf, die entweder ganz neu entstanden sind (Shein, Picnic) oder aus dem stationären Einzelhandel stammen (Zara, ALDI). Letztere Flächenbedarfe verschwimmen zwischen Onlinehandel und Handel im klassischen Sinne.
Der Flächenumsatz durch den Onlinehandel dürfte kurzfristig durch die aktuelle konjunkturelle Lage verhalten ausfallen. Die fortlaufende Veränderung des Konsumverhaltens sowie ein perspektivisch steigender Online-Anteil am Gesamtumsatz dürften dazu beitragen, dass der Onlinehandel auch in Zukunft eine wichtige Nachfragegruppe auf dem Logistikimmobilienmarkt sein wird.
Mit seinen außergewöhnlichen Extremwetterereignissen zeigt uns das Jahr 2023 ein für alle Mal auf, die Energietransformation endlich voranzutreiben. Die Sorge nimmt berechtigterweise zu, dass das Transformationstempo im Energiebereich zu langsam ist. Daher wurde im letzten Jahr beschlossen, für den vollständigen Strom in Deutschland erneuerbare Energiequellen aufzubauen. Die Photovoltaik-Strategie des Bundes inkl. des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht bis 2030 eine Leistung von 215 Gigawatt allein aus Sonnenenergie vor. Momentan kommen zu den 60 GW im Jahr 2022 jährlich rund sieben Gigawatt aus neuen PV-Anlagen hinzu.
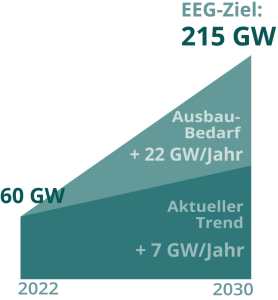
Um die genannten Ziele jedoch zu erreichen, müsste der Zuwachs um das Dreifache auf rund 22 Gigawatt steigen. Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Isar 2 verfügte zuletzt über eine Nennleistung von 1,49 Gigawatt und war damit eines der leistungsstärksten der Welt. Die Bedarfslücke ist offensichtlich. Ein Gigawatt entspricht knapp der Leistung eines durchschnittlichen Kernkraftwerks. Es müssten als gut 22 Kernkraftwerke dieser Art jährlich durch PV-Energie ersetzt werden.
Mit den großen Dachflächen von Logistik- und Industriegebäuden steht ein enormes Potenzial zur Verfügung. Ab einer Fläche von rund 5.000 m² fängt eine kommerzielle Ausnutzung der Dachflächen für Immobilienunternehmen an, wirtschaftlich tragfähig zu sein. Von dieser Größe ausgehend, steht in Deutschland ein kommerziell nutzbares Dachflächenpotenzial von 362,8 Mio. m² zur Verfügung.
Das mit Abstand größte Potenzial nach obiger Lesart besteht im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen. Hier stehen rund 82 Mio. m² Dachfläche zur Verfügung. Nahezu gleichauf liegen Bayern und Baden-Württemberg mit gut 59 bzw. knapp 52 Mio. m². In Niedersachsen finden sich immerhin noch knapp 42 Mio. m² Dachflächen. Die weiteren Bundesländer fallen dahinter zurück.
Wenn es gelänge, all diese Dachflächen mit PV-Modulen zu bestücken, so könnten über 36 Gigawattwatt potenzielle PV-Leistung auf diesen Dächern entstehen. Dies entspräche einer Leistung von über 36 durchschnittlichen Kernkraftwerken. Auch mit diesem Potenzial werden die geforderten 215 GW nur zu knapp 17 % gedeckt, zumal in den 60 GW Sockelbestand auch Logistikhallen enthalten sein dürften, die im Gesamtpotenzial aufgeführt sind. Dennoch wäre dies ein enormer Schritt in die richtige Richtung.
Bislang herrscht auf diesen Dächern allerdings vorwiegend gähnende Leere. Eine Auswertung von sieben größeren Logistikagglomerationen ergab, dass weniger als 10 % der Dachflächen mit PV-Modulen bestückt ist. Die Bandbreite reicht von gut 5 % in Erfurt bis hin zu 17 % im GVZ Großbeeren. Letzteres ist eher eine besser bestückte Logistiklage und eine Ausnahme. Ursächlich sind diverse neuere und größere Hallen, die tendenziell häufiger als Bestandsgebäude über PV-Module verfügen. Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, dass Neubauprojekte quasi standardmäßig mit PV-Modulen bestückt werden. Dabei kommen Jahr für Jahr ca. 5-6 Mio. m² neue Hallen- und somit auch Dachfläche hinzu. Dies ist verschenktes Solarpotenzial.
Ein ganzes Bündel an Ursachen ist dafür verantwortlich, dass der Ausbau nicht schneller vorwärtskommt, darunter:
Einer der Hauptursachen, warum nicht mehr großvolumige Photovoltaikanlagen auf gewerblichen Dachflächen montiert werden, ist schlicht die schlechte Relation zwischen den Erträgen aus der Vermietung von Dächern für Photovoltaikanlagen und den Mieteinnahmen der Halle selbst. Dies auch vor dem Hintergrund der enormen Komplexität, die ein PV-Engagement mit sich bringt. Der Betrieb einer eigenen Anlage kann für den Eigentümer allerdings durchaus interessant sein, vor allem wenn die Kosten der Anlage hoch auslaufend finanziert werden können. Planung, Finanzierung und Installation von PV-Modulen bleiben dennoch hochkomplex und viele Eigentümer von Hallen scheuen daher häufig ein Engagement. Dies trifft noch einmal mehr zu, wenn der erwirtschaftete Strom nicht selbst verbraucht wird, sondern eingespeist werden muss, da hier dann zunächst die entsprechenden Tarife bei der Bundesnetzagentur ersteigert oder entsprechende Power Purchase Agreements (PPA) geschlossen werden müssen.
Nicht immer ist es möglich oder gewollt, die auf dem Dach produzierte Energie durch den Mieter zu verbrauchen. Bei den Größenordnungen von Logistikhallen ist dies eher die Regel und der Strom muss in das Netz der Energieversorger eingespeist werden. Ab einer Anlagengröße von 1 MWp (ca. 10.000 m² Dachfläche) muss der Einspeisetarif nach aktueller Rechtslage ersteigert werden. Die Versteigerungen finden aber nur alle 3-4 Monate statt. Der ersteigerte Tarif ist dann die Untergrenze der Vergütung. Je größer die Anlage, desto besser gestaltet sich die spätere Wirtschaftlichkeit. Allerdings ist es häufig nicht klar, ob die produzierte Energie auch eingespeist werden kann. In Teilen ist das Stromnetz des Netzbetreibers ausgelastet und nicht klar, ob und wann überhaupt eingespeist werden kann. Die Informationslage und Kommunikation gestaltet sich hier mitunter auch schwierig, da mit den über 860 Netzbetreibern umfassende Abstimmungen erfolgen und administrative Hürden überwunden werden müssen.
Trotz aller Verbesserungen der letzten Jahre gestaltet sich die Finanzierung kommerzieller PV-Anlagen durch Banken teilweise schwierig. Banken werden solche Anlagen i. d. R. nur finanzieren, wenn eine Dienstbarkeit für das Dach ins Grundbuch eingetragen werden kann. Das Problem ist hier, dass meist schon Dienstbarkeiten für das eigentliche Gebäude existieren. Die Hierarchie dieser Dienstbarkeiten muss daher mit der ursprünglichen Bank verhandelt werden. Eine Finanzierung hängt dann maßgeblich davon ab, ob ein wirtschaftlich nachhaltiger Ertrag generiert werden kann. Diese ist aber häufig erst einschätzbar, wenn eine Netzverträglichkeitsprüfung (siehe Punkt 2) erfolgreich durchgeführt und der Tarif für die Einspeisung ins Stromnetz ersteigert wurde. Je größer die Anlage, desto größer die Ertragskraft und damit die Attraktivität für die finanzierende Bank. Denn der ersteigerte Tarif gilt als Mindestvergütung und damit Planungssicherheit. Der erzeugte Strom kann dann von Stromhändlern nach Möglichkeit oberhalb dieses Tarifs an der Strombörse erworben und gehandelt werden. Auch Stromhändler favorisieren möglichst große Anlagen. Die Anlagengröße, die Ertragskraft und die Finanzierbarkeit hängen aber wiederum von der Einspeisemöglichkeit ab und bilden somit fast einen Zirkelbezug, der gut austariert werden muss.
Eigentümer einer Halle sorgen sich häufig um Beschädigungen der Dachhaut bei der Montage von PV-Modulen, z. B. bezüglich der Dichtigkeit. Dieser Grund nimmt an Bedeutung zwar tendenziell ab, zumal professionelle Dienstleister hier umfassende Erfahrungen aufbauen konnten. Allerdings führen statische Gründe vor allem bei Bestandsgebäuden dazu, dass ein größerer Anteil der Hallen aus der potenziellen Nutzung herausfällt. Entweder reicht die Kapazität schlicht nicht aus oder es existieren keine geeigneten Datengrundlagen, um die statische Tragfähigkeit einschätzen zu können. Der Aufwand für die nachträgliche Anfertigung dieser Dokumente bzw. die Prüfung wird von einigen Eigentümern daher gescheut oder nur dann getätigt, sofern dies ohnehin notwendig ist, z. B. bei einer anstehenden Transaktion. Sofern die statische Eignungsprüfung positiv ausfällt und ein Generalunternehmer, der eine Anlage montieren kann, überhaupt gefunden wurde, kann der Bau in Angriff genommen werden. Die Komponentenverfügbarkeit fällt aktuell zwar generell wieder besser aus, aber es fehlen noch immer häufig Bauelemente, die den Bau ausbremsen. Derzeit sind es eher die Aufbauten, Trafos und Wechselrichter und die damit verbundene Abstimmung mit den Betreibern anstatt der eigentlichen PV-Module. Bei Anlagen zum Eigenverbrauch sind wiederum Zähler- und Messkonzepte zu erstellen, die den Weg des grün erzeugten Stroms nachvollziehbar machen und dokumentieren. Ist die Anlage erst mal montiert, kann die Einspeisung allerdings noch nicht starten, denn es muss ein Probebetrieb durchgeführt und die konforme Errichtung der Anlage durch einen Zertifizierer bestätigt werden. Die Wartezeit für diesen beträgt aktuell mehrere Monate.
Die Mieter einer Halle müssen der PV-Ausnutzung offen gegenüberstehen. Nicht nur, weil im Zuge der Installation die Mieter den Zugang zum Dach immer ermöglichen müssen. Auch müssen aus den Mietverträgen häufig Flächen herausgenommen werden (Carve-outs), z. B. für Aufbauten oder Infrastrukturen. Gerade bei Tripple-Net-Mietverträgen, bei dem der Mieter für das Dach verantwortlich ist, ist dies eine komplexe Hürde.
Einige Eigentümer geben ihre Dachflächen schlicht nicht zur Nutzung von PV-Strom frei. Ganz unterschiedliche Gründe kommen dafür in Frage, z. B. weil die Dächer als möglicher zukünftiger Drohnenlandeplatz oder anderweitig genutzt werden soll. Oder es bestehen bereits Aufbauten wie eine Attika, die eine Nutzung durch Schatten verhindern oder schmälern.
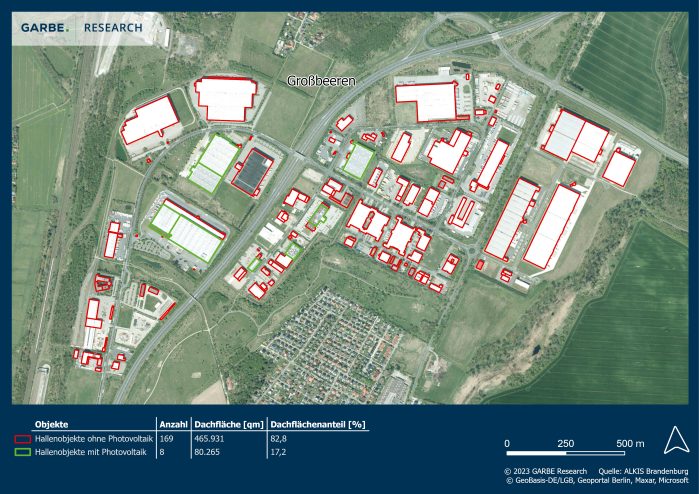
Es ist notwendig an einem Strang zu ziehen, um die Solarstromausbeute zu maximieren.
Zur Durchführung der Energiewende und der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft muss die Produktion von Solarstrom auf den Dächern massiv angekurbelt werden. Bei Neubauten muss das Ziel lauten, die PV-Nutzung von Anfang an in der Projektierung eines Gebäudes vorzusehen. Entsprechende Anschlüsse und Infrastrukturen sowie die notwendigen statischen Kapazitäten müssen eingeplant werden.
Bei Bestandsobjekten fallen durch die skizzierten Hürden vom theoretisch enormen PV-Potenzial von 362,8 Mio. m² rund 40 – 50 % der Dachflächen aus der Masse der kommerziell nutzbaren Hallen heraus. Die Hindernisse müssen daher ausgeräumt werden, um mehr Bestandsobjekte zu aktivieren. Die ausnutzbaren Dachflächen sollten sich daher eher in Richtung 65 %, optimalerweise eher 80 %, bewegen. Dies kann gelingen, indem für den Investor sichergestellt wird, dass der erzeugte bzw. potenziell erzeugbare Strom für eine möglichst hohe Mindestvergütung komplett eingespeist und damit kommerzialisiert werden kann.
Zwar sind die Netzbetreiber verpflichtet, in einem bestimmten Zeitraum den Strom komplett abzunehmen. Aktuell kommt es in der Praxis vor, dass eine Abnahme ohne nähere Angabe über Gründe, Dauer bis zur Möglichkeit der Einspeisung etc. verweigert wird, da ein Netzanschlusspunkt (NAP) erst für die Zukunft in Aussicht gestellt wird. Eine Planbarkeit ist dann nicht gegeben. Oder es wird von Betreibern ein NAP zugewiesen, der teilweise mehrere Kilometer weit weg zur Halle liegt und der auf eigene Kosten errichtet werden müsste. Hierfür wären Genehmigungen einzuholen, Erdbauarbeiten durchzuführen und Kabelwege zu legen. Eine Wirtschaftlichkeit ist dann nicht gegeben. Die Probleme lassen sich mit dem schlecht ausgebauten Verteilnetz zusammenfassen. Dieses müsste zügig und substanziell ausgebaut und ertüchtigt werden, um eine höhere sowie wirtschaftlich planbare Einspeisung zu ermöglichen.
Um hier wirklich Fortschritte zu machen, wird einerseits ein „Kümmerer“ bei den Eigentümern und Investoren benötigt, der sich durch die langwierigen und komplexen Einzelschritte durchkämpft. Gleichzeitig wird ein Investor benötigt, der das Kapital bereitstellt. Höhere Strompreise würden dabei helfen, die Ertragsrelation zu optimieren. Dies insbesondere dann, wenn die Komponentenpreise für die hohen Investitionen in Netztrafo, Wechselrichter usw. gleichzeitig sinken würden. Auch höhere ESG-Verpflichtungen für Eigentümer und Nutzer von Hallen würden unterstützen, um mit entsprechendem Druck die Positionen der verschiedenen Parteien im Gefüge aufeinander bewegen zu lassen. Letztendlich ist auch beim Thema Photovoltaik die Bürokratie so überbordend, dass hier umfassend angesetzt werden sollte, z. B. durch Abbau von administrativen Hürden, Abschaffung von Fristen abschaffen oder der Schaffung von Standards.
Gehen wir davon aus, dass es gelingt, 80 % der Dachflächen zu aktivieren, so sprechen wir bei Investitionskosten von 850 EUR pro kW von einem Gesamtinvestment von knapp 25 Mrd. EUR. Diese energiepolitische Zeitenwende ist für den Strukturwandel durchaus vertretbar, für einen Einzelinvestor aber zu viel Risiko. Es erscheint aber als erreichbares Ziel, zumal es deutlich nachhaltiger und wirtschaftlicher investiertes Geld ist als bei Atomkraftwerken, bei denen die Investitionskosten zwischen 7.000 und 12.000 EUR pro kW geschätzt werden. Von den Folgekosten ganz zu schweigen.
An dieser Stelle soll kein Fingerprinting durchgeführt werden. Vielmehr ist dieser Artikel ein Plädoyer dafür, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, um möglichst viel dieses Potenzials umzusetzen. Das Ziel sollte sein, dass es wirklich bald heißt: „Erst so leer, jetzt solar“. Zeitlichen Aufschub können wir uns nicht mehr leisten.
Die Schweiz liegt geografisch im Herzen Europas, weist aber durch ihre Neutralität einige Besonderheiten auf. Dies gilt auch für den Logistikstandort. Die dortige Logistikwirtschaft ist schwerpunktmäßig mit der Abwicklung der Güterströme (Im- und Export) beschäftigt, die durch die Kaufkraft und starke Industrie vergleichsweise hoch ausfallen. Aufgrund der hohen Lohnkosten sowie Grundstücks- und Betriebskosten nimmt die Schweiz jedoch keine Rolle als internationale Drehscheibe für physische Güter ein.
Die Logistikwirtschaft setzt sich überwiegend aus Speditionen und Verkehrsunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz zusammen. Produzierende Unternehmen verfügen meist über eigene Logistikabteilungen. So ist der Anteil der Eigennutzer von Logistikimmobilien überdurchschnittlich hoch. Da Logistikprozesse immer komplexer werden, zeigt sich auch in der Schweiz ein Trend zur Auslagerung an externe Logistikdienstleister. Eine weitere Besonderheit ist das Kabotageverbot, wonach Transportdienstleistungen innerhalb der Schweiz nicht durch ein ausländisches Unternehmen durchgeführt werden dürfen.
Das Marktvolumen der Logistikwirtschaft wird für das Jahr 2023 auf rund 44,4 Mrd. EUR geschätzt – dies entspricht rund 6 % des Bruttoinlandsproduktes. In Deutschland liegt der Anteil mit rund 300 Mrd. EUR bei 8 %. Im Jahr 2021 gab es landesweit knapp 186.000 Erwerbstätige in logistikrelevanten Berufen. Mit 3,7 % an allen Erwerbstätigen fällt der Anteil geringer aus als in Deutschland (5,3 %).
Den hohen Grad an Eigennutzern verdeutlicht etwa die Zahl der Bauinvestitionen, die bei Logistikimmobilien lediglich zu 10-20 % durch institutionelle Anleger getätigt werden. Zum Vergleich: Bei Büroimmobilien sind es etwa 30-50 %. Landesweit sind nur knapp 300 Liegenschaften anlagefähig (JLL, 2022). Der gesamte Flächenbestand umfasst rund 26 Mio. m² (CBRE, 2021), wovon der höchste Anteil auf die Kantone Basel (4,0 Mio. m²), Bern (3,5 Mio. m²), Zürich und Aargau (jeweils 2,9 Mio. m²) entfällt.
Durch die geringe Anzahl an Vermietungsobjekten und Verfügbarkeit von Bauland weist der Gebäudebestand ein relativ hohes Alter von durchschnittlich rund 30 Jahren auf. Insgesamt fehlt es vor allem an modernen Logistikflächen, die den aktuellen Nutzerbedürfnissen entsprechen.
Ballungsräume sind durch ihre Nähe zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten, Arbeitskräften sowie das dichte Verkehrsnetz in der Regel auch wichtige Standorte für die Logistikwirtschaft. Dies ist auch in der Schweiz so. Die Industrie- und Logistikflächen ziehen sich wie ein Band durch das dicht besiedelte Mittelland zwischen Bodensee und Genf. Im Mittelland befinden sich auch die Wirtschaftszentren. Das „goldene Städtedreieck“ Basel – Zürich – Bern weist eine sehr hohe Dichte an Industrie- und Logistikflächen – insbesondere entlang der Autobahn A1 zwischen Zürich und Bern.
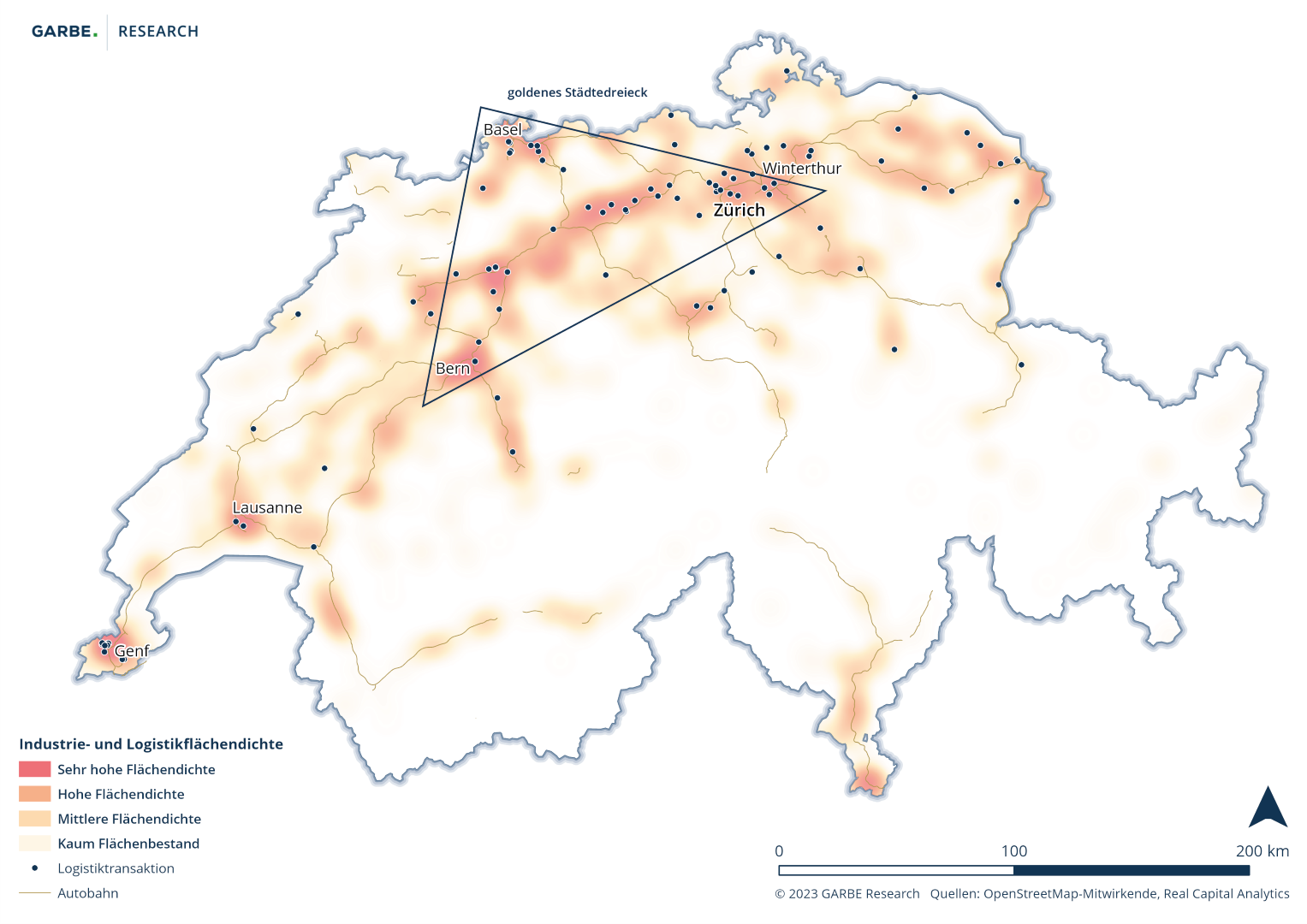
Abbildung: Industrie- und Logistikflächendichte und Verortung der Transaktionen von Logistikimmobilien in der Schweiz ab 5.000 m² seit 2015
Gerade in den Ballungsräumen ist der Wettbewerb um großflächiges Bauland besonders hoch. Bebaubare Grundstücke für größere Logistikzentren mit einer guten Verkehrsanbindung und entsprechenden Emissionsmöglichkeiten gibt es in der Schweiz kaum und werden von den Kommunen auch nur selten ausgewiesen. Sie legen das Planungsrecht bei Flächen für gewerbliche Nutzungen häufig sehr restriktiv aus und erhoffen sich eher emissionsarme Nutzungen mit einer hohen Arbeitsplatzdichte. Hinzu kommt die Topografie, die großflächige Logistiknutzungen vielerorts ausschließt. Die Flächenknappheit gilt insgesamt als eines der größten Hemmnisse für den schweizerischen Logistikimmobilienmarkt. Deshalb geraten Standorte außerhalb der etablierten Logistik-Hotspots stärker in den Fokus von Unternehmen. Wenn überhaupt, können sie oft nur dort Neubauprojekte realisieren.
Der Flächenbedarf für Logistiknutzungen in der Schweiz nimmt wie auch in anderen europäischen Ländern seit mehreren Jahren zu. Die Nachfrage kann bei weitem nicht bedient werden, womit man von einem Nachfrageüberhang sprechen kann. Im Zeitraum 2017 bis 2021 wurden durchschnittlich rund 200.000 m² an Logistikflächen auf Brachflächen und der grünen Wiese fertiggestellt (CBRE, 2021). Hier handelt es sich jedoch meist um kleinteilige Einheiten zur Eigennutzung. Vermietungsobjekte ab 5.000 m² machten im Jahr 2021 weniger als 5 % des Fertigstellungsvolumens aus. Spekulative Projektentwicklungen durch Investoren sind selten. Die Leerstandsquote ist dementsprechend gering und lag im Jahr 2022 bei 2,0 % bezogen auf den Gesamtbestand.

Das höchste Preisniveau wird in Zürich erzielt, wo die Spitzenmiete für moderne Logistikflächen zuletzt bei 20,50 EUR/m² lag. In Genf wurden für ähnliche Mietflächen 17,50 EUR/m² und im Wirtschaftszentrum Basel bis zu 15,00 EUR/m² in Premiumlagen aufgerufen. Zum Vergleich: Im teuersten deutschen Top-Markt München lag die Spitzenmiete bei knapp 10,00 EUR/m². Diesbezüglich ist auf das allgemein deutlich höhere Preisniveau in der Schweiz hinzuweisen, was den Abstand zu deutschen Logistikmärkten relativiert.
Durch die sehr restriktive Flächenneuausweisung und das generell geringe Angebot an Mietflächen sind die Spitzenmieten in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. In den vergangenen drei Jahren erhöhte sich die Spitzenmiete in den drei Spitzenmärkten um jeweils 17 bis 25 %. Durch die angespannte Marktsituation ist von einem weiteren Anstieg der Mietpreise auszugehen.
Die Assetklasse rückte in den letzten Jahren mehr in den Fokus von Investoren, die eine Diversifizierung ihrer Portfolios verfolgen. Der Nachfrageüberhang führt dazu, dass Logistikimmobilien insgesamt als sichere und stabile Anlage mit Entwicklungspotenzial wahrgenommen werden. Der Investmentmarkt für diese Assetklasse ist bedingt durch die überschaubare Menge an anlagefähigen Objekten, vergleichsweise klein. In den vergangenen Jahren gab es durchschnittlich zehn Transaktionen ab einem Wert von min. 10 Mio. EUR pro Jahr.
Das Transaktionsvolumen lag seit 2013 im Durchschnitt bei rund 450 Mio. EUR, wobei die Jahreswerte aufgrund der geringen Anzahl der Transaktionen sehr unterschiedlich ausfielen. Im Zeitverlauf lässt sich tendenziell eine höhere Marktaktivität ab 2013 erkennen. Im vergangenen Jahr wurde ein Rekordergebnis auf dem Investmentmarkt erzielt. Die europaweit zu beobachtende Zurückhaltung der Investoren zeigt sich auch in der Schweiz. Seit Jahresbeginn wurden lediglich 62 Mio. EUR umgesetzt.
Abbildung: Transaktionsvolumen Logistikimmobilien in der Schweiz 2007–2023*
Auch in der Schweiz haben sich seit Frühjahr 2022 die Finanzierungsbedingungen, wenn auch in einem geringeren Maße, deutlich verändert. Der Leitzins wurde schrittweise um 250 Basispunkte auf 1,75 % erhöht. Im selben Zeitraum stieg der EZB-Leitzins um 450 Basispunkte an. Dementsprechend fiel auch die Dekompression der Renditen in der Schweiz geringer aus. Die landesweite Spitzenrendite für Logistikimmobilien erhöhte sich seit dem Tiefstand im Mai 2022 um 60 Basispunkte, während es in Deutschland 100 Basispunkte waren.
Die Nettoanfangsrendite für Premium-Objekte lag zur Jahresmitte 2023 in Zürich bei 4,40 % und in Genf bei 4,60 %. Sie lagen damit ca. 40 Basispunkte über den Spitzenrenditen in den deutschen Logistik-Hotspots. In Basel lag die Spitzenrendite bei 5,20 %. Im dritten Quartal zeigte sich eine Stabilisierung der Renditen.
Spekulative oder Built-to-suit- Projektentwicklungen sind durch das häufig restriktive Planungsrecht sowie die hohen Grundstücks- und Realisierungskosten eher selten.
Der Investmentmarkt für Logistikimmobilien ist bedingt durch die allgemein hohe Kostenstruktur und den hohen Grad an Eigennutzern vergleichsweise klein. Spekulative oder Built-to-suit- Projektentwicklungen sind durch das häufig restriktive Planungsrecht sowie die hohen Grundstücks- und Realisierungskosten eher selten. Gleichzeitig entspricht der Immobilienbestand mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren oftmals nicht den heutigen Nutzeranforderungen. Es besteht ein hoher Investitionsbedarf, um den Bestand fit für die Zukunft zu machen.
Potenziale ergeben sich also vor allem in der Neupositionierung von Bestandsobjekten unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, was auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt. Durch den Trend zur Auslagerung von Logistikprozessen an externe Dienstleister könnten ehemals eigengenutzte Objekte auf den Markt kommen. Insgesamt können Bestandsobjekte aufgrund der hohen Flächennachfrage und guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz ein attraktives Investment darstellen.

Zum zweiten Mal fanden in diesem Jahr anlässlich der EXPO REAL die GARBE Real Estate Hockey Masters statt.
Gemeinsam mit unseren Kollegen, Freunden und Geschäftspartnern haben wir uns bereits einen Tag vor dem Beginn der Messe auf dem Spielgelände des Münchner Sportclub e. V. getroffen.

Die gestiegene Teilnehmeranzahl bei den GARBE Real Estate Hockey Masters im Vergleich zum Vorjahr unterstreicht den Erfolg dieser Veranstaltung. Diesmal kämpften 22 Spieler aus verschiedenen Bereichen der Immobilienbranche auf dem Kleinfeld um die begehrte Trophäe.
Nach intensiven Spielen stand das verdiente Siegerteam fest – herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Im Anschluss ließen wir den Tag gemeinsam auf der Wiesn ausklingen und stießen bei einer Maß Bier und einem halben Hendl auf das erfolgreiche Turnier an.








Vielen Dank an alle Turnierteilnehmer und besonders bedanken wir uns bei dem München Sportclub e. V. für die hervorragende Organisation des Turniers sowie bei dem MSC Heimservice für die Bewirtung bedanken.
Wir freuen uns schon jetzt, die Schläger bei den GARBE Real Estate Hockey Masters 2024 zu schwingen.

Wie geht es weiter in der Immobilienbranche? Dies war zweifellos eine der zentralen Fragen, die die Besucher der diesjährigen EXPO REAL beschäftigten – und sie fanden darauf auch Antworten.
Vom 4. bis 6. Oktober 2023 versammelten sich über 1.856 Aussteller aus 36 Ländern sowie mehr als 40.000 Teilnehmer aus 70 Ländern auf Europas größter Messe für Immobilien und Investitionen in München. Die Gesamtteilnehmerzahl setzte sich aus knapp 20.000 Fachbesuchern und 20.312 Unternehmensvertretern zusammen.

In diesem Jahr präsentierte sich GARBE erneut mit einem Messestand, an dem alle GARBE-Gesellschaften vertreten waren. Dadurch bot GARBE seinen Partnern und Geschäftskunden eine zentrale Anlaufstelle für alle vertretenen Assetklassen und Leistungsbereiche.
Die positive Resonanz zeigte sich auch in den zahlreichen konstruktiven Gesprächen – sei es bei einem entspannten Austausch an der Kaffee-Bar oder in den intensiveren Dialogen, die in den separaten Besprechungsbereichen stattfanden.







Die EXPO REAL mag vorbei sein, aber wir schauen bereits voller Vorfreude auf die vielseitigen Gespräche, die uns auf der EXPO REAL 2024 (04. – 06.10.2024) erwarten. Wir freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr auf dem GARBE-Stand begrüßen zu dürfen.
Die Nähe zu unseren Kunden und Partnern ist uns äußerst wichtig. Darum pflegen wir den persönlichen Kontakt auf Messen und Events. Informationen zu aktuellen und zukünftigen Veranstaltungen, sowie Impressionen von vergangenen Ereignissen finden Sie hier.
Mehr erfahrenUnsere duale Studentin Charlotte Steinmatz ist seit September 2021 bei GARBE an Bord und studiert Wirtschaftsingeneurswesen für Bau und Immobilien an der hochschule 21.
Wie das duale Studium aufgebaut ist, warum sie sich für ein duales Studium bei uns entschieden hat und wie sich ihr Alltag bei uns gestaltet, sehen Sie im Video.
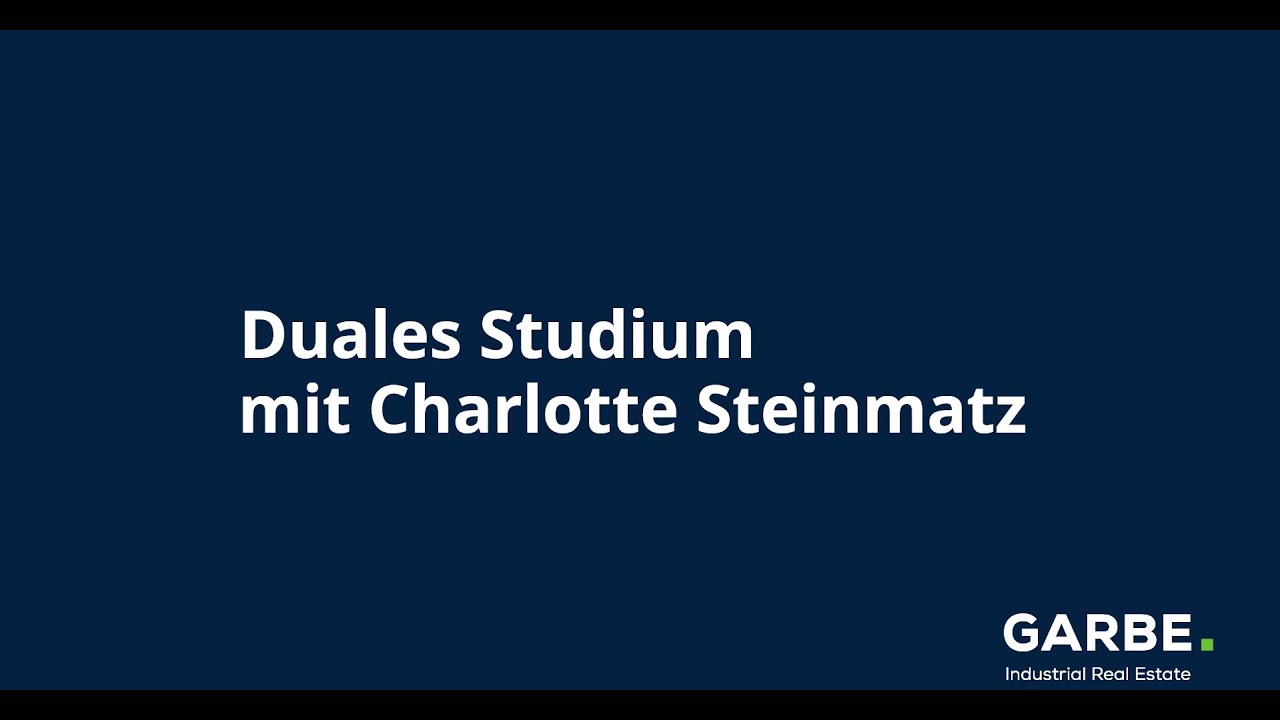
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Durch das duale Studium bei GARBE kann ich mich von Anfang an in die Abläufe des Unternehmens einbringen und frühzeitig Verantwortung übernehmen.Charlotte Steinmatz
Visionär, mit starken Bildern und eingehenden Worten eröffneten Zukunftsforscher und Moderator der Konferenz Max Thinius gemeinsam mit Christopher Garbe die zweite GARBE Vordenker Konferenz. Rund 140 Investoren, Bankenvertreter, Dienstleister und Geschäftspartner waren der Einladung in das Alte Hauptzollamt nach Hamburg gefolgt.
„Wir leben in der Digitalität, in der es nicht mehr große unbewegliche Strukturen gibt, sondern viele kleine dezentrale. Wir schauen nicht, was alles passieren könnte, sondern betrachten Möglichkeiten, analysieren sie und denken voraus,“ begrüßte Futurologe Max Thinius die Gäste. Die Konferenz dreht sich in diesem Jahr um drei Kernthemen:
Wie entwickelt sich die Zukunft der Arbeit und welche Immobilien brauchen wir dafür. Zum zweiten, wie der Gebäudetyp E umgesetzt und etabliert werden kann und zum Dritten, wie sich die Logistik als einer der sich am schnellsten verändernden Wirtschaftszweige entwickeln wird.
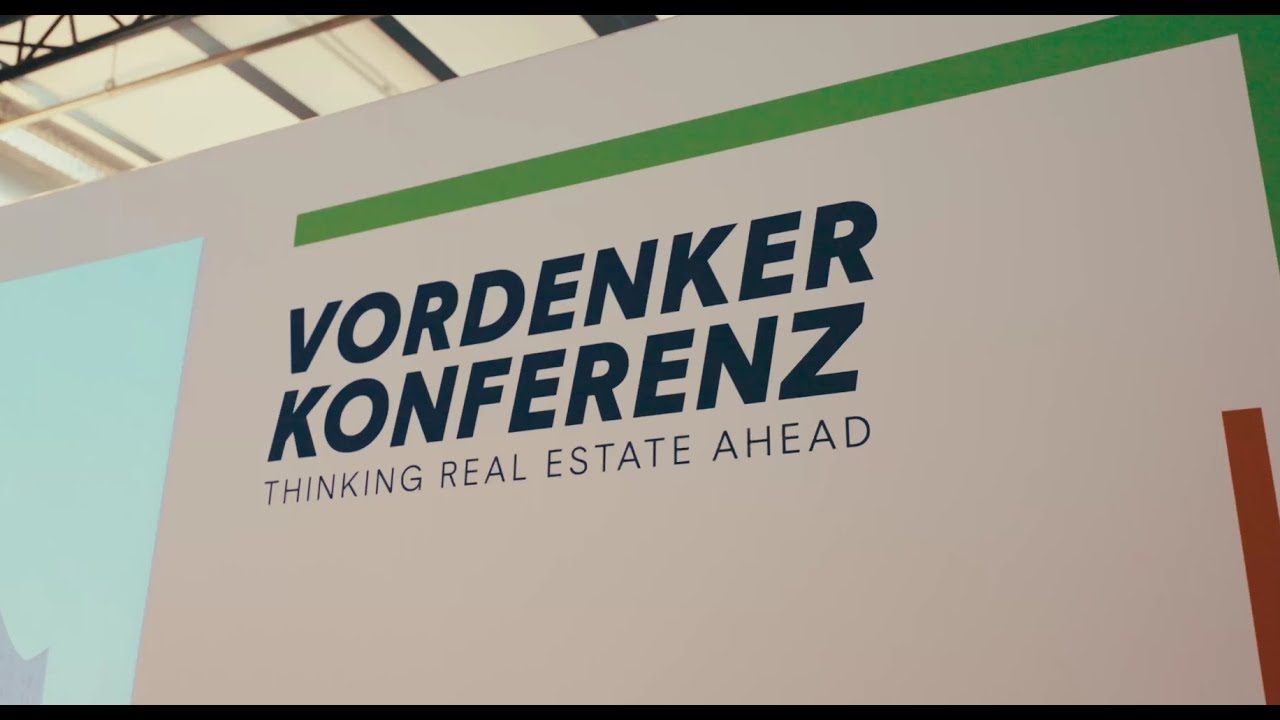
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
In einem ersten Vortrag zeigte Kai Uwe Bergmann von der Bjarke Ingels Group anhand verschiedener Projekte, wie zukünftige Immobilien aussehen können. Sie verbinden die Anforderungen an einen neuen Arbeitsplatz, Energieeffizienz der Gebäude aber auch das Wohlbefinden der Menschen. So kann das neue Google-Headquarter in San Francisco rund 40 Prozent der benötigten Energie mit PV-Anlagen auf dem Dach gewinnen. Die Büroflächen sind modular und offen aufgebaut und können jederzeit an neue Anforderungen angepasst werden.
Für das Toyota Woven City Projekt stehen „Wellbeing“ und „Happiness“ im Fokus. Am Fuße des Mount Fuji entsteht eine einzigartige Kommune, die geprägt ist durch Holzgebäude, Arbeiten & Leben an einem Ort, besonderer Aufenthaltsqualität durch Parks sowie einem hohen Grad an Automatisierung. Bergmann sagt: „Toyota denkt nicht mehr in der Kategorie Auto, sondern in Mobilität und wie wir alles miteinander verbinden können.“ Mit weiteren Projekten wie in Paris oder auch die visionäre Idee von Icon von Büroräumen auf dem Mond wurden weitere visionäre Ideen zum Leben & Arbeiten der Zukunft aufgezeigt.
In der anschließenden Diskussionsrunde wurde das Thema „Science & Technology Real Estate: Standorte und Immobilien für Unternehmen mit Zukunft“ mit Katharina Kreitz von Vectoflow, Dr. Dirk Ehlers, Cellcolab, Dr. Nadine Galandi, Wissenschaftlerin und Beraterin, Dr. Dirk Scholl, Life Science Consulting gemeinsam mit Moderator Thomas Kallenbrunnen von GARBE Institutional diskutiert.
Zentrale Erkenntnis der Diskussion: Die Entwicklung von Clustern, also der Zusammenschluss von Unternehmen der gleichen Branche, aber auch Hochschulen und anderen Einrichtungen sind wichtig, damit sich der Science- und Tech-Bereich entwickeln kann.
Weiter ging es in zahlreichen Deep Dive Breakout Sessions, in denen Themen, wie beispielsweise Strategische Standortauswahl – ein Perspektivenwechsel aus Sicht des Kunden, Rechenzentren als neue Immobilienklasse oder Von Grau zu Grün – Revitalisierung der Westend Gardens als Best Practice Beispiel, diskutiert wurden.

Unternehmer Albert ten Brinke von der Ten Brinke Group B.V. ging am Nachmittag einem weiteren wichtigen Thema auf den Grund: „Geht bauen auch einfacher? Was können wir von unseren Nachbarn lernen?“ In einem unterhaltsamen Vortrag kam er zu dem Schluss, dass in Holland nicht alles besser ist – außer vielleicht der Käse, Fußball und die entspanntere Herangehensweise an Krisen.
So berichtete er von Problemen mit dem Stromnetz, Stickstoffvorgaben und der Wohlstandskommission, die Baupläne im Hinblick auf ihre Schönheit prüfe und alles teurer und komplizierter mache. Für Deutschland sehe er u. a. die Punkte Gewährleistungsfristen, Beschleunigung der Genehmigungsprozesse, weniger Einspruchsmöglichkeiten, niedrigere Steuern, Standardisierung bzw. Vereinfachung der Bauprozesse als Ansatzpunkte zur Verbesserung.
In der anschließenden Diskussionsrunde mit Albert ten Brinke, Ten Brinke Group, Melissa Ott, Futury, Jan Löhrs, Spine Architects / BDA Architekt, moderiert von Tobias Hertwig von GARBE Immobilien-Projekte zum Thema „Gebäudetyp E – einfach und experimentell. Realität oder Alice im Wunderland?“ wurde die Notwendigkeit von Innovationen in der Baubranche beleuchtet.
Melissa Ott sagte: „Wir brauchen Innovationen, die zur Nachhaltigkeit beitragen, aber auch wirtschaftlich sind. Unsere Branche ist zu wenig innovativ.“ Dies sei auch bislang kaum notwendig gewesen, weil immer alles rentabel war. Doch durch neue Einflussfaktoren wie ESG, Zinsen, Materialpreise und den demographischen Wandel sind wir mehr denn je gefordert.

Beim Thema „Energiewende, Nearshoring, Politik – Was sind die Game-Changer für Logistikimmobilien und Standorte?“ konstatierte Prof. Dr. Alexander Nehm, BWL – Spedition, Transport und Logistik; DHBW Mannheim drei Thesen:
Die erste lautete „Location Shift / Neue Standortdynamik“, die besagt, dass wir keine Deglobalisierung haben, sondern sich die Welt durch die Veränderungen der Lieferketten und Nearshoring neu ordnen würde. Als zweite These zeigte er auf, dass die „Strukturelle Nachfrage wieder hoch“ sei. So würden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce und Automotive zu 90 Prozent Doppelstrukturen aufbauen, also sowohl Produktion als auch Lagerhaltung und dadurch eine zusätzliche Nachfrage nach Flächen generieren. Als dritten und spannendsten Punkt führte Alexander Nehm aus, dass Logistikimmobilien zukünftig als kommunale Energieversorger, also lokale Kraftwerke, an Bedeutung gewinnen würden.
In der anschließenden Diskussion, moderiert von Jan Dietrich Hempel von GARBE Industrial diskutierten Alexander Nehm, Michiel Muller, Picnic und Friedrich Wilhelm Düsing, Metroplan Engineering zum Thema „Logistik verändert sich – Was sind die Anforderungen an die Immobilie?“
So führte Muller aus, dass die Anforderungen von E-Commerce-Anbietern anders seien als von Logistikern. Mit „We need nicer buildings“ fasste er die Anforderungen an gute Arbeitsbedingungen zusammen, die vor allem bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter von erheblicher Bedeutung sind. Denn für jeden neuen Picnic-Standort werden 500 bis 800 Mitarbeiter gesucht – und die bekommt man nur durch entsprechende Rahmenbedingungen.

Ingenieur Friedrich Wilhelm Düsing erläuterte zudem, dass es eine manuelle Bearbeitung von Aufträgen zukünftig nicht mehr geben werde: „Die Automatisierung ist alternativlos, bedingt durch den Mangel an Personal, steigende logistische Anforderungen und die Verknappung von Flächen.“ Dieser These wurde von Picnic-Chef Muller für den Bereich Food bezweifelt, denn ein Roboter sei noch nicht fähig individuelle Lebensmittellieferungen zusammenzustellen. Insgesamt wurde der Logistikbranche wenig Innovationskraft in den vergangenen Jahren bescheinigt.
Alexander Nehm konnte den Krisen der letzten Monate hierzu positives abgewinnen: „Das gute an der Krise ist, dass der Handlungsdruck so hoch ist, dass endlich Innovation entsteht. Man sieht: Es kann dann doch schneller gehen, und bald werden wir nur noch nachhaltige Produkte auf dem Markt sehen.“
Zum Abschluss der Konferenz wagten Christopher Garbe und Ulrich Wickert einen Ausblick. Es sei offen, wie sich die Situation in der Ukraine entwickeln werde, und Deutschland sei zwar in einem „desaströsen Zustand“ in Bezug auf Digitalisierung, Netzausbau und Bildungspolitik, doch es gebe Hoffnung, dass die Innovationskraft der Wirtschaft, Wissenschaft & Technik und auch ein gewisser Innovationsgeist der Immobilienwirtschaft die Probleme der Zukunft gemeinsam lösen lassen.

Die Lieferkettenprobleme wurden mit erhöhter Lagerhaltung sowie Re- und Nearshoring-Strategien bekämpft. Der Druck auf die ohnehin knappen Flächen und Grundstücke wurde damit erhöht. In der Energiepolitik musste in kürzester Zeit die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl reduziert werden. Als kurzfristige Lösung wurden LNG-Terminals realisiert, die dieses Ziel grundsätzlich erreicht haben. Ein nachhaltiger Ansatz sieht aber anders aus. Das Ziel, sich bis 2035 vollständig regenerativ mit Energie zu versorgen, wird dadurch nicht erreicht. Logistik- und Industrieimmobilien könnten mit ihren enormen Dachflächen durch die Produktion von Solarstrom einen gewaltigen Hebel darstellen. Statt pragmatisch und zielorientiert dieses Potenzial auszuschöpfen, werden die Ambitionen nach wie vor von bürokratischen und regulatorischen Fallstricken ausgebremst. Dabei zeigen die ESG-Strategien der Immobilienwirtschaft, dass sie hoch motiviert sind, ihren Anteil zur Umsetzung der Energiewende beizutragen.
Neben dem Flächen- und Energiemangel gibt es eine ganze Reihe weiterer Problemfelder in der deutschen Wirtschaft. Die Digitalisierung kommt nur schleppend voran. Und auch der Industrie steht eine Mammutaufgabe bevor, indem sie sich auf den Energieträger Wasserstoff ausrichten muss. In einer visionären Herangehensweise könnten Logistikimmobilien bzw. deren Standorte neben Distribution und Fotovoltaik neue Funktionen aufnehmen und so einen wirksamen Teil bei der Lösung dieser Problemfelder darstellen. Die Verringerung der Flächenversiegelung, Erhöhung der Versorgungssicherheit und Katalysator beim notwendigen Umbau des Wirtschaftsstandortes Deutschlands wären die Resultate. Eine spürbare Erhöhung der Breitbandkapazitäten und die Produktion von Wasserstoff wären dabei inkludiert.
Als finale Evolutionsstufe wäre es dann keine Logistikimmobilie mehr, sondern vielmehr eine Infrastrukturimmobilie, die weitaus mehr leistet als nur die Distribution des Güterflusses.
Der klassische Kernauftrag einer Logistikimmobilie samt allen Spielarten der Dienstleistungstiefe inklusive einzelnen Produktionsstufen in der Wertschöpfungskette bleibt auch weiterhin ein prägendes Merkmal. Der Bedarf wird durch das florierende Brot-und-Buttergeschäft, Wiedererstarken des E-Commerce-Trends samt vollflächiger Quick-Commerce-Angebote sowie in Gang gesetzter Re- und Nearshoring-Strategien zur Minimierung von Abhängigkeiten weiter zunehmen.
Das Potenzial für Fotovoltaik auf den Logistik- und Industriedächern Deutschlands ist enorm. Dennoch kommt der Ausbau nicht richtig in Fahrt. Die Gründe sind vielfältig und zu umfangreich, um in diesem Artikel thematisiert zu werden. Neben den Dächern werden auch Fassadenelemente verstärkt ins Visier genommen. Noch ist diese Art der Energieerzeugung nicht sehr effektiv, aber der technische Fortschritt wird sich auch hier niederschlagen. Die Produktion von Solarstrom wird weiterhin an Relevanz zunehmen und zum Regelfall werden – wenn die Hürden konsequent abgebaut werden.
Regenerative Energieproduktion bezieht sich in Deutschland zumeist auf Fotovoltaik oder Windkraft. Nicht nur der Ausbau von Fotovoltaik stottert, auch das Windkraftpotenzial wird aktuell kaum ausgeweitet. Verheerend, wenn der Strombedarf bis 2045 drastisch um 43 % auf rund 1.000 Terawattstunden ansteigen wird. Logistikimmobilien spielen bislang bei Windkraft kaum eine Rolle. Denn bei Windenergie wird stark auf die üblichen Anlagen mit Rotoren gesetzt, die mit der Logistikimmobilie nur schlecht vereinbar sind. Unter anderem die Abstandsregelungen, Schlagschattenwürfe und Lärmemissionen verhindern dies. Logistikimmobilien mit ihren langen und vergleichsweise hohen Fassaden können jedoch an anderer Stelle bei Windenergie punkten. Da sich mehrgeschossige Immobilien immer mehr durchsetzen werden, wird die Höhe und damit das Potenzial eher noch zunehmen. Denn an den Fassaden entstehen Aufwinde, die durch neuartige Walzen-Anlagen aufgefangen und in Strom umgewandelt werden. Die neuartigen Generatoren werden an den Traufkanten der Immobilien montiert, sodass sie die PV-Anlagen auf dem Dach kaum beeinträchtigen. Zwar sind diese Modelle noch Prototypen, besitzen aber das Potenzial, die Bedeutung der Logistikimmobilie als Kraftwerk zu erhöhen.
Spätestens wenn die letzten fossilen Kraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden und die Energieproduktion vollständig regenerativ erfolgt, kann es schnell zu einem Grundlastproblem kommen. Denn nicht immer scheint die Sonne oder gibt es genügend Wind, um jeden Tag rund um die Uhr die im Netz benötigte Energie zu erzeugen. Batteriespeicher können hier eine Lösung darstellen und gewährleisten, dass zum einen regenerativ maximal produziert werden kann und keine Anlagen mehr still stehen muss, da die Aufnahmekapazität der Netze erschöpft ist. Zum anderen kann so auch in den sonnen- oder windarmen Monaten bzw. Tageszeiten genügend Energie bereitgestellt werden. Der elektrifizierte Individual- und Schwerlastverkehr wird immer mehr Stromkapazitäten benötigen. Daher werden Batteriespeicher zur Lösung des Grundlastdilemmas unabdingbar. Erste Batteriespeicheranlagen sind in Deutschland bereits im Bau, weitere Anlagen werden folgen. Logistikanlagen entwickeln sich zunehmend zu kleinen Kraftwerken in einem dezentralen Stromnetz. Sie können die Nutzer bzw. das Quartiersumfeld mit der hier produzierten Energie versorgen. Überschüssige Energie könnte hier direkt gespeichert und Stromverluste durch lange Leitungswege vermieden werden. Logistik-Kraftwerke inklusive Batteriespeicher werden somit zu einem wesentlichen Bestandteil, um die Energiewende tatsächlich stemmen zu können.
Politik und Unternehmen streben eine zunehmend nachhaltig durchgeführte Produktion in Deutschland und Europa an. Der Einsatz von grünem Wasserstoff – z. B. bei der Stahlproduktion – ist dabei wesentlicher Hebel. Bei der Herstellung des Wasserstoffs wird jedoch viel Energie benötigt und erzeugt dabei Abwärme. Die zukünftigen Lkw-Flotten werden vermutlich zu größeren Teilen mit Brennstoffzellen angetrieben. Es bietet sich an, die Energieproduktion auf Logistikimmobilien mit der Wasserstoffproduktion direkt zu kombinieren, da hier die Produktionsfaktoren unmittelbar auf Abnehmerstrukturen treffen. Nicht verwendeter Wasserstoff kann an die umgebenden Produktionsbetriebe oder kommunale Abnehmer abgegeben werden. Ein teilweise oder zukünftig vollständiges Einleiten in Erdgas- oder Wasserstoffleitungen kann ebenso erfolgen. Die Kombination von Logistikanlagen mit Wasserstoffproduktion kann die ambitionierten Ziele des von der EU angestrebten „Green Deals“ bzw. der EU-Wasserstoffstrategie wirksam unterstützen.
Die Digitalisierung schreitet mit enormem Tempo voran. Wichtige Stichworte sind hier Industrie 4.0, Digitalisierung der Automobilbranche sowie E-Commerce inklusive flächendeckender Quick-Commerce-Konzepte. Auch für Logistik- und Industrieimmobilien wird es immer wichtiger, über Hochgeschwindigkeitsanbindungen zu verfügen. Denn die autonom betriebene Mobilität wird mittelfristig Realität und auch die Logistik stark beeinflussen. Bereits heute besteht ein eklatanter Mangel an Lkw-Fahrern – Tendenz steigend. Daher wird die autonome Fortbewegung allein aus diesem Grund zwingend. Autonomes Fahren ist jedoch sehr datenintensiv und Deutschland ist ungenügend darauf vorbereitet, die benötigten Bandbreiten darzustellen. Dies auch, weil der Ausbau von Glasfaser sehr tiefbaulastig und damit langsam und teuer ist. Schneller und wirkungsvoller könnte hier der umfassende Ausbau von modernen Mobilfunktechnologien sein. Geeignete Standorte für die benötigten Antennen zu finden, gestaltet sich jedoch immer schwieriger. Logistikimmobilien können auch hier an bislang unterversorgten Standorten eine Alternative darstellen. Die Dachflächen können um Mobilfunkmasten ergänzt oder bei hohen Immobilien direkt montiert werden. Die Logistikhalle würde in diesem Verständnis quasi eine Mobilfunkantenne. Das umfassende Netz von Logistikimmobilien auch an dezentralen Standorten könnte vor allem die Breitbandversorgung in der Versorgung der Gegenden abseits der Kernstädte unterstützen.
Neben der beschriebenen Digitalisierung in der Wirtschaft forciert auch die gestiegene Nachfrage bei Videotelefonie und Streamingdienstleistungen den Bedarf an Rechenzentren. Denn zur Umsetzung der dringend benötigten Digitalisierung ist nicht nur der Transport von Datenpaketen notwendig, sondern auch die Verarbeitung dieser Daten in Rechenzentren. Aus Gründen der Sicherheit oder zur Minimierung der Latenzen werden diese auch in Deutschland dringend in größeren Stückzahlen notwendig. Die für Rechenzentren benötigten Grundstücke ähneln denen der Logistikimmobilie frappierend. Die Problemlagen allerdings auch. Besonders Flächen- und Stromkapazitäten sind bei beiden Immobilientypen häufig Mangelware. Ein Grund mehr, beide Nutzungsarten zu kombinieren und die Flächenversiegelung zu reduzieren. Die auf Logistikimmobilien produzierte Energie könnte direkt in die Rechenzentren eingespeist werden. Güter- und Datentransporte erfolgen in dieser Kombination Hand in Hand.
Viele Gebäude in Gewerbelagen produzieren quasi als Abfallprodukt Wärmeenergie. Die drohende „Gas-Mangellage“ hat vergangenes Jahr jedoch aufgezeigt, dass dringend Alternativen zur Gas-Heizung benötigt werden. Daher gilt es, die Wärmepotenziale durch Fernwärmekonzepte besser auszunutzen. Sofern die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyseure immer stärker ausgerollt wird und auch bei Logistikanlagen anzutreffen ist, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Abwärme dieser Anlagen nicht direkt mitgeplant und zur Versorgung des umgebenden Quartiers genutzt wird. Gleiches gilt für Rechenzentren.

Hören Sie mehr zu diesem spannenden Thema in unserem Podcast Logistics Real Estate Insights. Hier diskutierten Tobias Kassner und Jan Dietrich Hempel über dieses Thema und stellten sich die Frage, inwieweit Logistik- und Industrieimmobilien einen positiven Beitrag zur aktuellen Situation leisten können.
Jetzt bei Apple, Spotify oder direkt im Browser reinhören.
Es ist nicht davon auszugehen, dass in Kürze sämtliche Logistikimmobilien über all die oben beschriebenen Merkmale verfügen. Einige Techniken sind noch im Prototypenstadium. Und auch aus wirtschaftlicher, baurechtlicher, steuerrechtlicher oder technischer Hinsicht gibt es viele der „typischen“ Hindernisgründe. Sinn würde die Bündelung diverser Funktionen bei der Logistikimmobilie aber aus ähnlich vielen Gründen machen. Allen voran würde einer der bisherigen Hauptvorwürfe gegenüber Logistikimmobilien – der Flächenfraß – relativiert werden. Statt an vielen verschiedenen Standorten die einzelnen Infrastrukturen zu errichten, werden diese nach Möglichkeit an einem Standort gebündelt. Die bisherige Hauptnutzung Logistik bleibt weiterhin vorhanden, tritt aber angesichts der weiteren Nutzungen ein Stück weit in den Hintergrund. Neben Gütern und Paketen werden aber auch Elektronen und Bits und Bytes transportiert. Viel mehr noch als Kapital wird der Wille aller Stakeholder notwendig sein, um eine solche Vision einer „Infrastrukturimmobilie“ zu realisieren. Der Veränderungsdruck für einen zügigen Wandel des „Mindsets“ ist jedoch vorhanden.
Frankreich kann auf eine lange Geschichte als Handelsnation zurückblicken. Jahrhunderte lang haben Importe und Exporte die wirtschaftlichen Aktivitäten geprägt und den Grundstein für die heutige Position als einer der wichtigsten europäischen Logistikmärkte gelegt. Mit dem viertgrößten Seehafen Europas in Marseille, einem der größten Flughäfen Europas und seiner zentralen, westlichen Lage ist Frankreich einer der Dreh- und Angelpunkte der westeuropäischen Logistik. Doch wie kann das Land seinen Status als Top-Markt auch in Zukunft halten? Erfahren Sie hier alles über die aktuellen Entwicklungen auf dem französischen Logistikimmobilienmarkt.

| Logistikflächenbestand: 49,2 Mio. qm (Q2 2022) (2018-Q 2/2022: +5,0 % Ø-jährliches Wachstum; +9,6 Mio. qm) |
|
| Spitzenmiete: EUR 5,80/qm (Q4 2022 – Update Juli 2023) (2018-2022: +4,8 % Ø-jährliches Wachstum; +EUR 1,20/qm) |
|
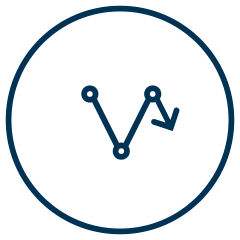 |
Spitzen-Nettoanfangsrendite: 3,90 % (Q4 2022 – Update Juli 2023) (2018-2022: -4,5 % Ø-jährliches Wachstum; -1,00 %-Punkt) |
| Investment Volumen: EUR 7,6 Mrd. (2022) (2018-2022: +17,5 % Ø-jährliches Wachstum; +EUR 3,6 Mrd.) |
Mit seinen rund 68 Millionen Einwohner:innen ist Frankreich einer der am weitesten entwickelten und am längsten bestehenden Logistikmärkte in Europa. Seine Schlüsselposition kommt jedoch nicht von ungefähr. Das Land zwischen der Nordsee im hohen Norden, dem Rhein im Osten, dem Mittelmeer im Süden und dem Atlantik im Westen hat seit jeher eine einzigartige Beziehung zum Wasser, die seine Stellung als Handelsnation und damit seinen Ursprung als Top-Logistikmarkt schon vor Jahrhunderten begründet hat. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 2,6 Billionen Euro im Jahr 2022 ist Frankreich die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa und die siebtgrößte weltweit.
Die etablierten Logistikregionen in Frankreich konzentrieren sich hauptsächlich entlang des so genannten „Backbone“, der von Lille über Paris und Lyon nach Marseille verläuft. Weitere etablierte Logistikregionen sind Straßburg, Nantes, Bordeaux und Toulouse. Die anderen Logistikregionen des Landes sind Le Havre am Ärmelkanal, Dijon, ein Knotenpunkt für den Verkehr zwischen Paris, Lyon und Straßburg/Deutschland, sowie Nizza an der Côte d’Azur.
Frankreich ist einer der wichtigsten Logistikmärkte in Europa. Trotz eines Logistikflächenbestands von gut 49 Mio. m² ist das Angebot an hochwertigen Logistikflächen knapp, insbesondere in den Hotspots des Marktes. Dies zeigt sich durch eine durchschnittliche Leerstandsquote, die bei lediglich 3 % liegt. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage treibt das Mietpreiswachstum. Seit 2018 sind die Spitzenmieten für Logistikflächen im Ballungsraum rund um Paris um 26 % auf 5,80 €/m², für hochwertige Objekte, gestiegen.
Der gestiegene Appetit der Investoren auf Logistikimmobilien während der Corona-Pandemie hat sich markant auf den französischen Investmentmarkt ausgewirkt und den Aufwärtstrend der letzten Jahre verstärkt. Das Transaktionsvolumen für französische Logistikimmobilien erreichte im Jahr 2022 mit 7,6 Mrd. EUR trotz der Unsicherheiten auf dem Investmentmarkt und des knappen Angebots einen neuen Rekordwert. Die starke Nachfrage hat die Kaufpreise in der Zeit deutlich in die Höhe getrieben. Seit dem vierten Quartal sehen wir jedoch – wie in eigentlich allen europäischen Ländern – eine Zurückhaltung der Akteute auf dem Investmentmarkt. Wir gehen davon aus, dass spätestens Anfang 2024 wieder mehr Transaktionen erfolgen.
Insgesamt hat die wachsende Beliebtheit französischer Logistikimmobilien bei Investoren zu einer starken Renditekompression um 1,50 Prozentpunkte zwischen 2017 und 2021 geführt. Ende 2021 lag die Spitzenrendite bei 3,40 %. Im Verlauf des Jahres 2022 kam es zur Dekompression der Spitzenrendite auf 3,90 %. Einen detaillierten Überblick über die Spitzenmieten und Renditen in den einzelnen französischen Logistikmärkten im Jahr 2022 finden Sie auf unserer GARBE Pyramid.
Im Marktsegment Logistik ist Frankreich durch die zentrale Lage innerhalb Europas und die gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur einer der führenden Standorte in Europa. Auch das Entstehen neuer europäischer Logistik-Hotspots und die EU-Erweiterung haben an dieser führenden Position nichts geändert. Die Beliebtheit von Logistikimmobilien während der Pandemie sowie die Entwicklung hin zum Re-/Nearshoring werden auf absehbare Zeit für eine steigende Nachfrage nach Immobilien und Flächen sorgen. Ein signifikanter Rückgang der Marktnachfrage ist daher in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Michael Vidamant,
Geschäftsführer Frankreich GARBE Industrial Real Estate France SAS verantwortlich für die Expansion in Frankreich.
Mit der Eröffnung der Pariser Niederlassung im Jahr 2021 verstärkt GARBE sein Engagement auf dem französischen Logistikmarkt. Wir haben Michael Vidamant, Geschäftsführer von GARBE Industrial in Frankreich, gefragt, warum das Potenzial des französischen Logistikmarktes noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Frankreich ist nach Deutschland die zweitgrößte Volkswirtschaft in Kontinentaleuropa, gemessen am BIP. Die geografische Nähe, die Qualität der Infrastruktur, die wirtschaftliche Stabilität und ein globalisiertes Logistikangebot bestärken den Gedanken, dass Frankreich ein Schlüsselgebiet für die europäische Entwicklung von GARBE Industrial ist.
Auch deutsche Investoren sind seit jeher in Frankreich präsent. Im Jahr 2022 beteiligten sie sich mit 5 % an den Logistikinvestitionen. Mit einer Niederlassung in Frankreich kann GARBE seine Kunden auch außerhalb seines historischen Heimatmarktes unterstützen.
Schließlich muss der Begriff „kompakter“ Markt in Bezug auf den französischen Markt relativiert werden, da die Logistik- und Industrieinvestitionen 2022 in Deutschland 9,6 Mrd. Euro und in Frankreich 7,6 Mrd. Euro betrugen. Diese beiden Märkte stehen nach UK an zweiter bzw. dritter Stelle in Kontinentaleuropa und machen zusammen über 40 % der Logistiknachfrage in Kontinentaleuropa im Jahr 2022 aus.
Auch wenn sich dieser Trend weiterentwickelt, ist Frankreich nach wie vor ein zentralisiertes Land, in dem ein Großteil der Transaktionen über den „Backbone“ (von Lille bis Marseille) abgewickelt wird. Deutschland verfügt über sieben Top-Standorte, die sich regional verteilen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Logistikregionen, die in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Top-Standorten an Bedeutung gewonnen haben.
Historisch gesehen ist das Mietpreisniveau in Frankreich niedriger als in den wichtigsten europäischen Ländern. So stiegen die Spitzenmieten in der Logistik in Europa zwischen 2021 und 2022 um 12 %. Während das Mietwachstum in Paris 9 % betrug, erhöhte sich die Spitzenmiete im selben Zeitraum in München um 17 %.
Dennoch entwickelt sich der Logistikmarkt in beiden Ländern ähnlich: rückläufiges Angebot, robuste Nachfrage, kaum vorhandene Leerstände und steigende Mieten, wenn auch auf einem deutlich niedrigerem Mietniveau als in Deutschland.
Die Logistik in Frankreich ist seit dem Ende der 2000er Jahre institutionalisiert, wo erstmals die Marke von 2 Mrd. EUR an Investments in Logistikimmobilien überschritten wurde. Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass sich diese Anlageklasse stärker entwickelt hat als andere wie Einzelhandel, Büros oder Hotels. Durch den Aufschwung des Onlinehandels hat die Logistik sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in Frankreich etabliert. Durch seine zunehmende Bedeutung konnte das Logistikangebot auf Regionen ausgedehnt werden, die bisher nicht etabliert waren. Wir gehen davon aus, dass sich das nationale Logistiknetz ähnlich wie in Deutschland weiter räumlich ausdifferenzieren wird. Hierbei stehen etablierte als auch Wachstumsbranchen im Fokus.
Wie in den meisten europäischen Ländern begleitet der Onlinehandel den wirtschaftlichen Wandel, den die französische Gesellschaft durchläuft. Um diesen Wandel fortzusetzen und gleichzeitig seine Attraktivität zu steigern, integriert der Logistiksektor ökologische Kriterien bereits in einem frühen Stadium seiner Produktionskette. Dies schafft einen Mehrwert für die Nutzer, aber auch für die Gebiete.
Die Covid-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine begünstigen die Aufrechterhaltung und Rückkehr bestimmter Aktivitäten, die zuweilen im Ausland durchgeführt wurden, was zur Unterstützung der künftigen Nachfrage beitragen dürfte.
Auch der Bedeutungszuwachs von ökologischen, technischen und technologischen Aspekten sowie des Erscheinungsbildes und der angebotenen Dienstleistungen bei Nutzern und Investoren, verstärkt den Gedanken, dass im Bestand und bei Projektentwicklungen das Angebot entsprechend ausgerichtet werden muss.
In der Vergangenheit entfielen zwei Drittel des Flächenumsatzes auf den Backbone (Lille – Paris – Lyon – Marseille). Die Schwierigkeit, verfügbare Grundstücke zu finden, die Komplexität der Verwaltungsverfahren, der steigende Preis in Verbindung mit den Baukosten, die in den historischen Logistikgebieten deutlich höher sind als früher, verstärken die Entwicklung der als zweitrangig betrachteten Standorte. Dank eines sehr guten Verkehrsnetzes, erschwinglicherer Grundstückspreise und geringerer Konkurrenz werden die Hauts de France, der Atlantikbogen und Grand Est tendenziell mehr Marktanteile erobern.
Der europäische Logistikimmobilienmarkt ist trotz der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr vital. Im Fokus der Investoren stehen dabei vor allem die großen Märkte Deutschland, UK, Frankreich und Niederlande. Ein Land, das dabei von vielen Investoren übersehen wird, ist Belgien. Der Markt ist bislang noch stark durch Eigennutzungen geprägt, gewinnt aber aufgrund der räumlichen Lage im Herzen Europas und hohen Flächennachfrage in dieser wirtschaftsstarken Region immer mehr an Attraktivität.
Durch die anhaltend hohe Nachfrage, die geringe Leerstandsrate sowie ein Mangel an Baugrundstücken in vielen Regionen steigen die Mieten. Diese Entwicklung wurde zuletzt durch die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten noch einmal beschleunigt. Insgesamt führen diese Aspekte zu einer hohen Attraktivität dieser Assetklasse, wenngleich Investoren auch bei Investments in Logistikimmobilien zuletzt durch die veränderten Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt eher zurückhaltend waren.
Die wichtigsten Logistikimmobilienmärkte in Europa sind Deutschland, UK, Frankreich und die Niederlande. Dort erfolgt auch ein erheblicher Anteil der Investments in Logistikimmobilien. Ein Markt im Zentrum der Blauen Banane, der dabei oft von vielen europaweit agierenden Investoren übersehen wird, ist Belgien. Das Land mit seinen rund 11,6 Mio. Einwohner:innen verfügt über starke wirtschaftliche Verflechtungen mit seinen Nachbarländern. Die generell hohe Wirtschaftskraft weist jedoch innerhalb des Landes starke regionale Unterschiede auf. Während man im Großraum Brüssel und Flandern eine Vielzahl an produzierenden Hightech-Unternehmen sowie wissensintensiven Dienstleistungen findet, ist Wallonien noch stark vom Strukturwandel der Montanindustrie geprägt.
Belgien ist seit dem Mittelalter ein wichtiger Handels- und Produktionsstandort sowie ein bedeutender Umschlagsplatz. Der Hafen Antwerpen-Brügge ist heute nach Rotterdam der wichtigste Seehafen in Europa und übernimmt auch für deutsche Unternehmen eine wichtige Funktion. Knapp 30 Prozent des dortigen Umschlages entfiel auf diese Gruppe. Belgien zeichnet sich durch eine attraktive Infrastruktur mit einem sehr dichten Straßen- und Schienennetz aus. Neben den beiden großen Seehäfen gibt es auch zahlreiche gewerblich geprägte Wasserstraßen. Die wichtigsten Umschlagsplätze für Luftfracht sind die Flughäfen in Brüssel (Zaventem) und Lüttich.
Die Logistikwirtschaft spielt in Belgien eine wichtige Rolle für die Wirtschaft und den Handel. Das Land verfügt über eine hochentwickelte Logistikindustrie, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet. Die Branche ist insbesondere in der Region Flandern gut etabliert, wo sie für einen bedeutenden Teil des BIP verantwortlich ist. Darüber hinaus haben viele internationale Unternehmen ihre europäischen Logistikzentren in Belgien angesiedelt.
Der Bestand an Light Industrial und Logistikimmobilien summierte sich im ersten Quartal 2023 auf rund 44,1 Mio. m², wobei rund 70 % davon auf Flandern und jeweils rund 15 % auf den Großraum Brüssel und Wallonien entfallen. Seit 2019 ist der Immobilienbestand in diesem Segment um rund 14 % gewachsen. Die Leerstandsquote ist in den vergangenen Jahren trotz des immensen Zuwachses an Gebäudefläche kontinuierlich gesunken und lag zuletzt bei lediglich 0,9 %.
Grund hierfür ist die anhaltend hohe Flächennachfrage, die in den letzten Jahren immer neue Rekorde erzielt hat. In den vergangenen zehn Jahren umfasste der Flächenumsatz durchschnittlich 1,73 Mio. m², wobei in der ersten Hälfte der Umsatz bei 1,39 Mio. m² und in der zweiten Hälfte bei 2,06 Mio. m² lag. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten gab es im Jahr 2022 nur einen geringfügigen Rückgang des Flächenumsatzes und auch im ersten Quartal 2023 lag der Flächenumsatz mit rund 330.000 m² auf einem durchschnittlichen Niveau. Die hohe Nachfrage äußerte sich in einem deutlichen Anstieg der Spitzenmiete. Diese erhöhte sich seit 2013 in den Logistikregionen Brüssel und Antwerpen um jeweils etwa ein Drittel.
Im Vergleich zu den Niederlanden zeigt sich, dass der belgische Logistikimmobilienmarkt stark durch Eigennutzungen geprägt ist. Dementsprechend ist der Investmentmarkt deutlich kleiner. Während seit 2008 in Belgien durchschnittlich rund 20 Transaktionen pro Jahr erfolgten, waren es in den Niederlanden ca. 195. Das Investmentvolumen fiel in den Niederlanden etwa acht Mal so hoch aus wie in Belgien. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre wurden rund 350 Mio. EUR pro Jahr in Belgien umgesetzt, wobei die höchsten Ergebnisse jeweils in den letzten drei Jahren erzielt wurden. Der Fokus der Investmentaktivitäten liegt auf den beiden größten Städten Brüssel und Antwerpen sowie dem Korridor zwischen den beiden Metropolen. Im geringeren Maße trifft dies auch auf andere flämische Regionen wie Gent und Genk zu. Die Zahl der Investments in Wallonien fiel in den vergangenen Jahren gering aus.
Abbildung 2: Transaktionen für Light Industrial und Logistikimmobilien in Belgien 2000–2023 Quelle: Real Capital Analytics, GARBE Industrial Real Estate
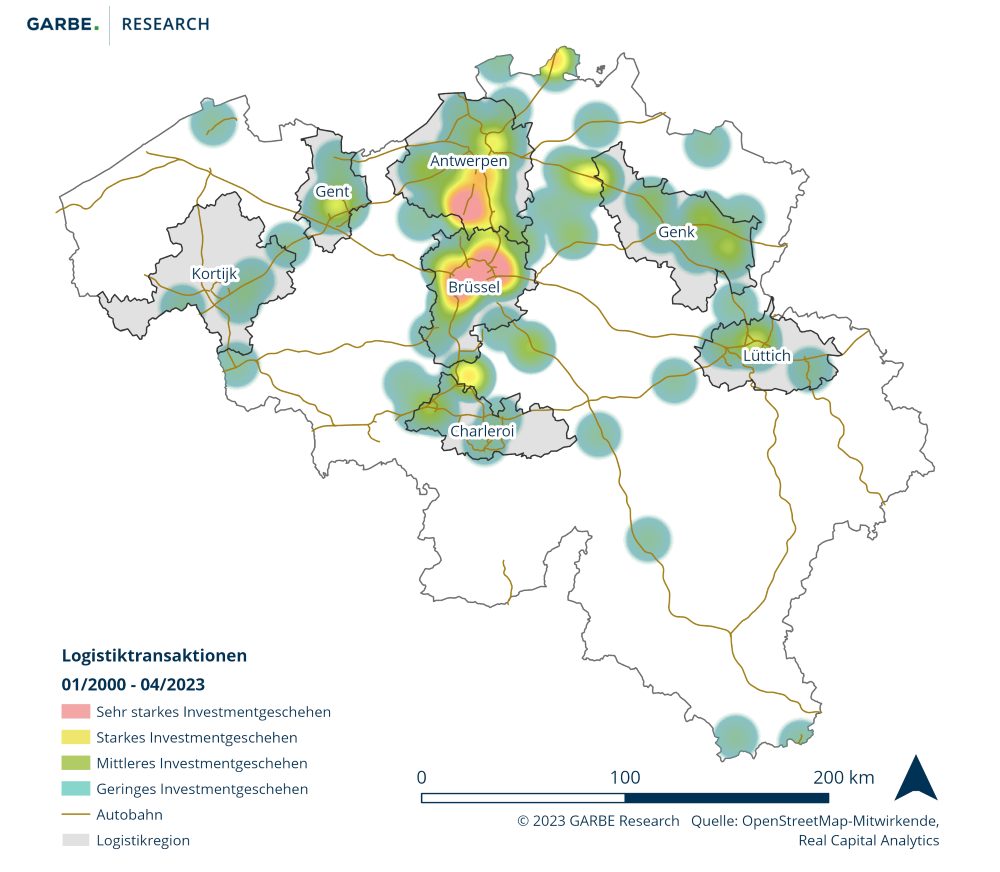
Wie in den meisten europäischen Top-Märkten war auch auf dem Investmentmarkt für Logistik- und Light Industrialimmobilien in Belgien eine starke Renditekompression in den vergangenen Jahren zu beobachten. In Brüssel und Antwerpen verringerte sich diese jeweils von rund 7,00 % im Jahr 2013 auf zuletzt 4,60 bzw. 4,50 %. Zum Vergleich: Damit liegt sie über den Vergleichswerten in den Top-Märkten der Nachbarländer Deutschland (3,40 %) und Niederlande (4,20 %). Aufgrund der geo- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen stiegen die Renditen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in allen drei betrachteten Top-Märkten deutlich an.
Belgien weist durch die zentrale Lage innerhalb Europas und die gut ausgebaute Infrastruktur eine hohe Standortattraktivität auf. Durch die räumliche Nähe zu anderen wichtigen europäischen Absatzmärkten sowie die Seehäfen in Antwerpen und Brügge ist Belgien ein bedeutender Logistikstandort mit Potenzialen.
Belgien hat eine starke Wirtschaft mit Branchenschwerpunkten in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Lebensmittelverarbeitung. Diese Branchen benötigen Logistik- und Lagerflächen, um ihre Produkte zu lagern und zu vertreiben. Die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Belgien steigt aufgrund des Wachstums des E-Commerce und der steigenden Bedeutung von Lieferkettenoptimierung. Hinzu kommen geplante Investitionen in erneuerbare Energien, wie etwa Offshore-Windparks an der belgischen Küste. Die Anforderungen an die Logistikinfrastruktur werden dabei immer komplexer und erfordern mehr Flexibilität und Effizienz.
Der belgische Logistikimmobilienmarkt bietet Investoren attraktive Rahmenbedingungen, da die Nachfrage nach Logistikimmobilien steigt, aber das Angebot begrenzt ist. Dies führt zu einer höheren Miete und einer höheren Kapitalrendite. Insgesamt bietet der belgische Logistikimmobilienmarkt eine vielversprechende Möglichkeit für Investoren, von den Vorteilen einer günstigen geografischen Lage, einer starken Wirtschaft und einer wachsenden Nachfrage nach Logistikimmobilien zu profitieren.
Wir setzen Cookies zur Optimierung unserer Werbemaßnahmen und Inhalte ein. Sie können alle Cookies akzeptieren oder nur die, die für die Nutzung der Seite notwendig sind. Die Auswahl kann in der Datenschutzerklärung geändert werden. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.